Bin gleich wieder da
Diese Farbe. Als ich vor dem ersten Bild aus »Los Alamos« stehe, Wolken, die drachengleich einen Himmel aus tiefem Kobaltblau stürmen, fühle ich mich zurückversetzt in die Stunde, als ich ein »Monochrome bleu« von Yves Klein gesehen habe. Hundertmal war mir das Bild zuvor in Katalogen, Büchern, Zeitschriften begegnet, nun sah ich zum ersten Mal das Funkeln des Originals.
Es ist diese Farbe. Reproduktionen vermitteln nur eine ferne Ahnung von der Macht, mit der ein Originalabzug des Fotografen William Eggleston berührt. »Los Alamos« zeigt ausschließlich Prints, die mit dye transfer hergestellt worden sind, einem ungewöhnlich aufwändigen, inzwischen auch von Eggleston nicht mehr angewandten Verfahren, bei dem die verschiedenen Farbschichten mit Hilfe von vier Matrizen nacheinander auf das Papier aufgetragen werden. Es gewährt dem, der mit der komplizierten Technik vertraut ist, eine besonders feine Kontrolle der Parameter; allerdings kann sich die Arbeit an einem Abzug über Tage hinziehen.
Es ist das Kobalt, das über einer zerfledderten Markise lastet, das Azur über einem mit bunten Glühbirnen drapierten Dach, einem Hangar, einer verrosteten Laterne, das Indigo über einem Pornokino, einem Parkplatz, über der Reklame für einen Reifenhändler, über einem Fertighaus mit Antenne, das Ultramarin, das einen Topf mit Stoffblumen grundiert, das Graublau hinter einer Imbissbude, einer Tankstelle. Dabei hatte ich gedacht, Rot wäre seine bevorzugte Farbe.
Rot, sagt er selbst, sei die schwierigste Farbe überhaupt. Die Arbeit an seinem berühmten Bild der von Lampenkabeln durchschnittenen Decke eines Bordells, »The Red Ceiling« (1973), vergleicht er mit dem Spielen eines Bachschen Exerzitiums, »ein wenig Rot reicht normalerweise schon, aber eine vollständig rote Oberfläche ist eine Herausforderung. Es war sehr schwierig. Ich kenne gar keine völlig roten Bilder, außer in der Werbung.« (»Ancient and Modern«, London 2002) Die Wand sehe aus wie mit frischem Blut getüncht. »Diese Fotografie ist noch immer kräftig. Sie schockiert dich jedesmal.«
»Los Alamos« ist benannt nach einem Sperrbezirk, in dem die Atombombe entwickelt wurde. »Ich hätte gern selbst so ein Geheimlabor«, sagte der Fotograf zu dem Kurator Walter Hopps, als sie 1973 an der mit Wäldern umgebenen Anlage vorbeigekommen waren. Die frühesten Stücke aus dem Zyklus reichen ins Jahr 1966 zurück, als Eggleston in Farbe zu arbeiten begann. Sie werden nun in Köln zum ersten Mal gezeigt. Nehmen wir an, dass er sich an Rot zunächst nicht herangewagt hat. Hier und da erscheint es schon, meist voll und glühend, auf Ketchup-Flaschen, die ein von ihm bevorzugtes Sujet bleiben werden, auf Papierherzen, auf den Lederbezügen von Straßenkreuzern, in Rücklichtern.
In diesem ältesten farbigen Zyklus findet sich, im Unterschied zu Egglestons bekanntesten, »Guide« (New York 1976) oder »The Democratic Forest« (London 1989), nicht nur Pastell, sondern auch Kontrastarmes; ein Tank aus Zink, der, als wäre er ein verirrtes U-Boot, auf einem nassen Acker gestrandet ist, oder zwei verrostete Zapfsäulen in Karmesin. Auf dem Teer der Straße ist der Platzregen zu erkennen, der niedergeht, man glaubt ihn auf das Blechdach der verlassenen Tankstelle hämmern zu hören.
Im Gegensatz zu späteren Werkphasen – der »Democratic Forest« z.B. ist fast menschenleer –, gibt es noch relativ viele Porträts, etwa vom Lehrling eines Supermarkts, der Einkaufswagen zusammenschiebt; eines der ersten Farbfotos Egglestons. Er hat sich von den Menschen wegbewegt, dabei ist er, wie seine Schwarzweißaufnahmen aus den frühen Sechzigern beweisen, ein perfekter Porträtist, wenn er auch die Menschen so sieht wie die Dinge, von ferne, fasziniert und doch Abstand haltend, mit dem Blick eines Mannes, dem nichts Menschliches fremd, aber auch nicht nahe ist. Die mit Talmi besteckte Hochfrisur einer rauchenden Frau nimmt er, wie eine Trophäe, von hinten auf, einen Mann mit Filzhut durch das spiegelnde Glas einer Telefonzelle, eine Frau im Halbdunkel eines großen Wagens, gelangweilte Flipperspieler, den Gast eines Schnellrestaurants oder einen jungen Tankwart von der Seite, eine Familie gar aus der Deckung eines Kühlers. Nur auf Alte und Kinder geht er direkt zu, das Bildnis eines Jungen, der sich eine schwarze Schlange um den Hals gewunden hat, fällt auf und erinnert an den neugierigen in Winston, der sich einen Waffenkatalog ansieht, oder an den ebenso neugierigen mit Schlapphut in Franklin (beide »Democratic Forest«).
Man muss nichts über diesen Fotografen wissen, um an seinen Bildern zu erkennen, dass er ein loner ist, ein wortkarger, störrischer, eigenbrötlerischer Mann, ein Southerner. Die Anekdoten, die über ihn erzählt werden, halte ich deshalb alle für wahr; in meiner liebsten heißt es, es hingen nur deshalb so viele Fotos in der Wohnung seiner Geliebten in Memphis, weil sich unter jedem ein Einschussloch befinde, in meiner zweitliebsten bricht er nachts, auf der Suche nach einem geöffneten liquor store, mit seinem Cadillac durch ein Stahltor; als der Wagen zum Stehen kommt, dringt aus dem Wrack noch immer mit voller Lautstärke die »Messe in b-Moll« von Johann Sebastian Bach.
Man muss ihn sich auf einer Veranda vorstellen, ein Objektiv oder eine Waffe polierend. Nach 1976 beginnt er zu fotografieren, wie man mit einer Flinte schießt, ohne durch einen Sucher zu schauen, denn eine Flinte hat keinen. »Es gibt dir viel mehr Freiheit, du kannst die Kamera in die Höhe halten, als ob du riesig groß wärst. Du schaust dann, wenn du umherläufst, viel eindringlicher. Und wenn die Zeit gekommen ist, ein Foto zu machen, ist alles bereit.« Dann muss er ins Schwarze treffen, denn zu seinen Prinzipien gehört es, von einem Motiv nur eine einzige Aufnahme zu machen, damit er hinterher nicht zwischen zwei oder mehreren ähnlichen wählen muss. Er trifft oder er trifft nicht.
»Anders als bei einem Gewehr, bei dem du sorgfältig auf einen Punkt oder auf einen Abschnitt zielst, tust du es bei der Schrotflinte nach Gefühl. Du schaust nicht den Lauf hinunter und richtest ihn aus. Mit einer geschmeidigen Bewegung folgt dein Körper einem beweglichen Ziel, und die Waffe dreht sich nach dem Schuss mit einem so genannten follow through (Nachhalten) weiter. Das geht ins Blut über. Gute Schießlehrer werden dich zum follow through anhalten. Es ist das Gegenteil der rationalen Methode. Als ich zum ersten Mal Abzüge vor mir hatte, die so entstanden waren, sahen sie wie Schrotflintenbilder aus.«
Aber schon in »Las Alamos«, entstanden von 1966 bis 1974 auf Fahrten durch das Mississippi-Delta, in Südkalifornien und Las Vegas, begleitet u.a. von Dennis Hopper, hat er sich von der rationalen Perspektive abgewandt. Er zentriert selten, er schneidet fast immer an. Schon zu dieser Zeit entfernt er sich von Walker Evans, den er als junger Mann noch sehr verehrt hat. Dessen in seinen letzten Jahren entstandene Polaroids, deren Motive sich auch bei Eggleston häufig finden – Reklametafeln, Aufschriften auf Pappe, auf Wänden, auf Straßen, Schilder –, zeigen den Unterschied deutlich. Evans geht auf das Objekt zu, konzentriert sich völlig auf es, seine Kadrierung ist fast immer rechtwinklig. Ein großartiges Werk, das erst jetzt, 30 Jahre nach Evans‘ Tod, geborgen wird, doch nüchtern und seriell gedacht, intelligent, klassisch, ohne die Schwüle, die Brutalität, den Wahnsinn, die Weite des Südstaatlers.
»Wenn es etwas gab, was ich an Walker Evans’ Arbeit nicht mochte, war es sein Entschluss, immer dieselbe, quadratische, frontale Ansicht zu wählen. Ich hatte nie viel übrig für Fotos mit solchen frontalen Ansichten.« Gerade seine Verschiebungen aber entfernen ihn von der Registratur des Klassikers. Eine verchromte Seeburg-Jukebox wäre von vorn aufgenommen eine hübsche Reminiszenz, leicht angewinkelt von unten, noch dazu mit einem Schlagschatten, vor einer Wand in schimmligem Grün, zeigt sie doch eine erstaunliche Verwandtschaft mit Darth Vader. Die winzige Verschiebung in Perspektive und Farbgebung bringt alles aus dem Gleichgewicht. An Orten, die wir zuvor für die sichersten und langweiligsten der Welt gehalten hätten, tut sich – und mit welcher Leichtigkeit! – ein Abgrund des Trivialen, Phantastischen und Grausamen auf.
Das Alltägliche sieht bei ihm aus wie ein scene of the crime. Eudora Welty hat das als erste festgestellt. »Hier ist eine gerade verlassene Theke in einem Autobahn-Schnellrestaurant. Sie ist zugestellt mit ungewaschenen Plastiktellern, alle von tropfendem Rot, wie ein Tatortfoto der Polizei, samt einer mit Tomatenketchup geschriebenen, an dich adressierten Nachricht (›Fang mich, bevor ich den nächsten Mord begehe‹).« Mir kommen ganz ähnliche Phantasien, z.B. bei den weißen Pullovern, die auf einer Waschmaschine liegen. In der Totalen wären sie vielleicht bloß Wäsche, im Anschnitt sind sie Beweisstücke. Oder bei einem mit leichtem Weitwinkel aufgenommenem Wagen, der vor einer Imbissbude parkt, vielmehr sich bedrohlich vor ihr aufbaut, das schmale Heckfenster ist stumpf, die Standlichter strahlen, aber nirgendwo ist jemand zu sehen. Wir müssen annehmen, dass sie alle erschossen sind und zwischen zerbrochenen Ketchupflaschen in ihrem Blut liegen.
Nicht menschenleer seien viele dieser Szenerien, bemerkt Welty, sondern nur gerade von Menschen verlassen, deren Spuren noch frisch sind. Hier lehnt ein Wischmop, den die Hausfrau vergessen hat. Da steckt eine Säge im Balken, der Bauarbeiter wird in einer Minute zurück sein. Dort hat sich einer eine Axt bereitgelegt. »Bin gleich wieder da«, steht auf dem Zettel des Massenmörders.
In andere Dinge scheint der Dämon gefahren zu sein. In das abgewetzte Karussellpferd, das wie eine schäumende Furie erscheint. Oder in den rosa Plastikfisch in dem abgestellten Gartenspringbrunnen aus Terrakotta. Schnappt er nicht nach Wasser? Automobile, das ist gerade in »Los Alamos« nicht zu übersehen, sind für Eggleston Persönlichkeiten; Diven, Schurken, Bettler. Diese Dinge leben.
Ein Extrem ist erreicht, wenn ein leerer Raum sich allein kraft der Bildkonstruktion erfüllt. In der Ecke eines betonierten Hinterhofs, wohl eines Ladens, steht ein wenig Gerümpel, eine Kiste, daneben eine einsame Flasche Coca-Cola, auf der Tür sind große rote Buchstaben angebracht, deutlich ein »E«. Vollkommene Trostlosigkeit, durchquerten nicht die asymptotischen Schatten zweier Säulen die Szene; eleganter lässt sich Spannung nicht erzeugen. Kein Künstler vor und nach Eggleston hätte dort etwas gesucht, nur er hat dort etwas gefunden.
Wenn er über das Menschliche und Natürliche hinausgeht, dann mit der größten Coolness. Er deutet nur zart an, er verschmäht die Fotografie als Hieb, als Gag, all die schreienden Platituden, die Mache, mit der ein Illustriertenmann sich vom andern absetzen will. Wie aber ist es möglich, dass solche Banalitäten so sehr beeindrucken? Wie können ein rosa Plastikfisch oder ein ausrangiertes Schaukelpferd zu Hauptdarstellern von Tragödien werden? Wie ist es zu erklären, dass ich an der Schönheit dieser Ketchup-Flasche, dieses Parkschilds, dieses Sondermülls mein Leben lang achtlos vorüberging? Die Antwort auf die letzte Frage bleibt. Weil ich kein Amerikaner bin.
Ein Amerikaner tut die Oberfläche nicht leichtfertig ab, um einer Tiefe willen, die es nicht gibt. Er hat noch ein Verhältnis zur Schönheit. Mir muss die Welt, die mir Eggleston zeigt, wie ein Schutthaufen erscheinen, den ein Gott illuminiert hat. Aber es gibt keinen Gott, es gibt nur diesen Schutthaufen. Das ganze Geheimnis, sagt Wittgenstein, ist, dass es kein Geheimnis gibt. »Die Dinge liegen unmittelbar da vor unseren Augen, kein Schleier über ihnen.«
Die Museumsleitung handelte gedankenlos genug, als sie »Los Alamos« vor einem Saal mit der allerüblichsten Pop Art platzierte. Denn nach diesen smarten Stücken müssen Warhol & Co. plumper, aufdringlicher, öder noch erscheinen als ohnehin schon. Eine Coca-Cola-Dose von Rauschenberg und eine von Eggleston, das ist ein Unterschied, auf dem ich künftig beharren will. Ich durchquere den Saal und gelange wunderbarerweise zurück in Egglestons grausam-schöne Welt. Die weitläufige Schau der Werke von Hans Peter Feldmann (Jungle World, 13/2000) zeigt neben vielem anderen einen originalgetreuen Nachbau der Zellen dreier Frauen, die in Köln-Ossendorf eine lebenslängliche Haftstrafe verbüßen. Ich betrete die erste Zelle noch mit einem ängstlichen Blick auf die Tür. Aber die Schulklassen und Führungen streben, wie schon an »Los Alamos«, achtlos vorüber; niemand erlaubt sich den Scherz, die Tür ins Schloss zu werfen.
Die Wände in den winzigen Räumen haben die Frauen mit Familienfotos, Devotionalien, naiven Gemälden und Dekorationen zugehängt. Und da sind wieder diese starken Farben, Rot, Blau, Grün. Das hätte Eggleston fotografiert, denke ich, irre weiter, und treffe, als ob es so sein müsste, in einem Nebenraum Yves Klein, »Monochrome bleu«, vom Tageslicht weit genug entfernt gehängt, damit das Blau die Augen nicht verbrennt.
William Eggleston: Los Alamos. Museum Ludwig, Köln, bis 9. Juni
Thomas Weski, Hg.: William Eggleston. Los Alamos. Scalo, Zürich, Berlin, New York 2003, 175 S., 40 Euro
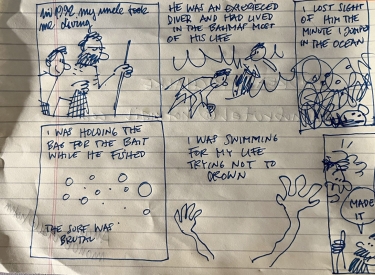



 Die Axt im Wald der Cancel Culture
Die Axt im Wald der Cancel Culture