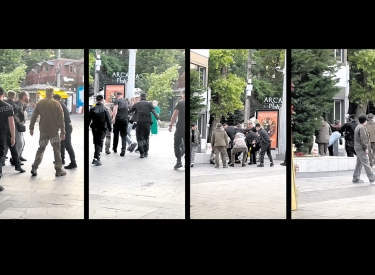Wer F sagt, muss auch S sagen
Der moderne Staat entstand aus der Staatsanleihe. Diese hatte den Krieg zur Voraussetzung und führte zur Steuer. Die Kreditaufnahme und die Rückzahlung der Schulden sind ein Verteilungsproblem. So weit das Grundsätzliche.
Am Hundertjährigen Krieg (1339–1453) zwischen England und Frankreich störte die beteiligten Monarchen vor allem, dass er so teuer war. Weil es sich, anders als bei früheren Waffengängen, nicht nur um einen kurzen Feldzug handelte, bei dem wenigstens der Sieger schnell abkassieren konnte, war für lange Zeit keine Erholung in Sicht. Dazu mussten die neuen, teuren Feuerwaffen beschafft werden. Der König von Frankreich half sich, indem er bei reichen Leuten Kredite aufnahm und ihnen das Recht einräumte, das Geld bei seinen Untertanen wieder einzutreiben. So entstand die Staatsanleihe, und mit ihrer Rückzahlung durch das Volk war die Steuer erfunden. Sie wurde beibehalten, nachdem der Kredit getilgt war, ging aber fortan direkt an den Monarchen. Damit das alles seine Ordnung hatte, musste ein bürokratischer Apparat errichtet werden. Voilà, der Staat.
Das funktioniert nun schon seit Jahrhunderten. Kredite dienen immer wieder politischen Maßnahmen, die ohne sie kaum möglich wären. Im 19. Jahrhundert stellte der konservative Nationalökonom Adolph Wagner das nach ihm benannte Gesetz vom »zunehmenden Wachstum der Staatsaufgaben« fest, und er hielt diese Entwicklung für ein Zeichen des Kulturfortschritts. Wer F sagt, muss auch S sagen: Staatsaufgaben zu erfüllen ist ohne Staatsausgaben nicht recht möglich.
Klassenpolitisch passen die Anleihen gut zum Kapitalismus. Sie bringen den reichen Gläubigern Zinsen, die von allen Steuerzahlern, auch den ärmeren, aufgebracht werden müssen.
Wichtig beim Schuldenmachen ist eine klare Strategie für die spätere Tilgung. Als das Deutsche Reich im August 1914 Kriegsanleihen aufnahm, gingen seine Regenten und auch die zustimmungsbereiten Sozialdemokraten davon aus, dass man bis Weihnachten das Geld zurück habe, wenn nämlich das besiegte Frankreich Reparationen zahlen müsse wie anno 1871. Das Marne-Wunder führte aber in die Probleme der Jahre 1339 bis 1453 zurück. Reparationen mussten schließlich doch gezahlt werden, ab 1919 von Deutschland. Damit kam das Anleihewesen erst richtig in Schwung, jetzt mit dem internationalen Großgläubiger USA. Inzwischen waren Bonds selbst zu Waren geworden, die an der Börse gehandelt wurden, womit der Kulturfortschritt die nächste Stufe erreicht hatte.
Auch Hitler plante, als er mit den so genannten Mefo-Wechseln die Aufrüstung finanzierte, ihre künftige Rückzahlung bereits mit ein: durch die Ausplünderung der zu überfallenden Länder. Die Rechnung ging nur indirekt auf. Deutschland verlor zwar den Krieg, im Zeichen der Systemauseinandersetzung nach 1947 fiel aber die Schuldenregelung großzügig aus, und der Aufschwung machte alles noch erträglicher.
Anleihen sind auch in der Innenpolitik ein probates Mittel, und zwar seit John Maynard Keynes. Um einer Rezession vorzubeugen oder sie zu beheben, schlug Keynes unter anderem staatliche Finanzspritzen vor, die durchaus auch mit Krediten bezahlt werden sollten. Sprang daraufhin die Konjunktur wieder an, so flossen höhere Steuern, und die Rückerstattung fiel nicht schwer. Keynes sprach von einem »Multiplikator-Effekt«: Jedes Pfund Sterling, das die öffentliche Hand ausgibt, lockt ein Mehrfaches an privaten Investitionen hervor. Und so wurde es in der Bundesrepublik nach 1949 ein Vierteljahrhundert mit Erfolg praktiziert, trotz Ludwig Erhards offizieller marktliberaler Rhetorik.
Als 1966 der Motor stotterte, legte der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) keynesianisch mit zwei Investitionsprogrammen nach. Die öffentliche Hand finanzierte in den sechziger und siebziger Jahren Schulen, Schwimmbäder, Universitäten, Professoren, Autobahnen und Rüstung und verarmte trotzdem nicht. Das geliehene Geld wurde regelmäßig und sicher wieder zurückgezahlt.
Es gab nur einen Nachteil: Die zuverlässig stimulierte Nachfrage auch nach Arbeitskräften machte die Gewerkschaften frech. Von ihnen erkämpfte Lohnerhöhungen konnten die Unternehmer zwar mühelos auf die Preise schlagen, aber die so erzeugte Inflation fraß die Tarifsteigerungen für die Lohnabhängigen wieder auf, und sie drohte die Bestände der Geldvermögensbesitzer anzuknabbern. Diese waren zwar weiterhin die hauptsächlichen Staatsgläubiger, aber die Entwertung traf auch ihre Bundesschatzbriefe.
Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in der gesamten kapitalistischen Welt kam es etwa ab 1974 zu einem Kurswechsel. Die Geldwertstabilität wurde zum obersten Gebot erklärt, dem Staat und den Gemeinden wurde von den Zentralbanken der Saft abgedreht. Scheinbar paradoxerweise wuchs gleichzeitig die öffentliche Verschuldung, die vorher nie ein Problem gewesen war. Sie stieg an und konnte, anders als früher, nicht mehr getilgt werden. Wie das?
Der Restriktionskurs brachte eine große Zahl von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger(innen) mit sich. Seit Anfang der sechziger Jahre waren die Sicherungssysteme tatsächlich ausgebaut worden. Man nahm an, dass sie bei weiterhin guter Konjunktur kaum gebraucht würden, allenfalls in wenigen individuellen Notsituationen. Die aber gab es jetzt massenhaft. Mit der Arbeitslosigkeit sank die Nachfrage und damit auch die Steuerzufuhr. Der Staat nahm – und nimmt – also weniger ein und musste dennoch mehr ausgeben. Um das ausgleichen zu können, pumpte er sich Geld.
Der Kanzlerkandidat der Union im Jahr 1980, Franz Josef Strauß (CSU), machte die Staatsverschuldung erfolglos zum Wahlkampfthema. Sein Nachfolger Helmut Kohl (CDU) versuchte sich tatsächlich zu Beginn seiner Amtszeit an der Sanierung der Staatsfinanzen. Jedoch nur bis zur Wiedervereinigung.
Erst die Regierung Schröder hat das Sparen so ernsthaft betrieben, dass das Finanzloch nun, im Jahr 2003, besonders groß ist. Der Kanzler und der Finanzminister erklären ein ums andere Mal, der Staat müsse sich wirtschaftsförmig verhalten, aber sie tun das gerade Gegenteil. Fast jedes Unternehmen, das gegründet wird, expandieren oder wenigstens nicht Pleite machen will, ist auf Fremdmittel angewiesen. Wer prinzipiell darauf verzichtet oder die Kreditaufnahme enger gestaltet, als es erforderlich ist, schränkt die eigenen Handlungsmöglichkeiten ein. Geiz und rote Zahlen hängen eng zusammen.
So weit die einfachsten Regeln aus dem volkswirtschaftlichen Grundkurs. Was aber macht Hans Eichel? Er behauptet, durch Schuldenabbau werde der Staat in Zukunft wieder aktionsfähig, obwohl schon die Gegenwart ihn Lügen straft. Ein probates Mittel, um den Staat in den Ruin zu treiben, war seine Steuer(senkungs)reform. Um den Bankrott abzuwenden, müssen dann doch wieder Kredite aufgenommen werden, und die Gläubiger, deren Steuerlast vorher schon gesunken war, kassieren die Zinsen.
Es gibt aber auch Interessenten, denen das Schuldenmachen ehrlich zuwider ist. Das sind die institutionellen Anleger, zum Beispiel die großen Versicherungen und die Betreiber von Investmentfonds. Für sie ist der Staat mit seinen Anleihen ein Konkurrent. Eine Einheit der bourgeoisen Klassenpolitik lässt sich aber durch die Forderung nach der Zerstörung der sozialen Sicherungssysteme wiederherstellen – und die Riesterrente öffnet einen neuen Markt.
Was also ist schlimmer als die gegenwärtige Krise der Staatsfinanzen? Die Antwort lautet: Die Politik, durch die sie entstanden ist und mit der sie behoben werden soll.

 »Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«
»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«