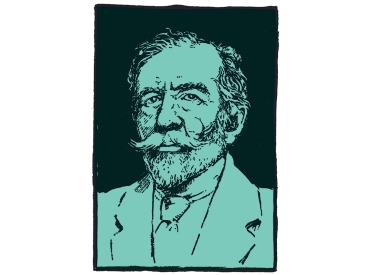Desaster Girl
anet Flanner, Kay Boyle, Lillian Hellman, Martha Gellhorn – Namen, die der US-amerikanischen Öffentlichkeit ein Begriff sind. Sie stehen für ausgezeichneten Journalismus, renommierte Magazine wie The New Yorker oder Colliers und für hohe Honorare.
Von Flanner abgesehen, die in frauenbewegten Kreisen allein deshalb wieder entdeckt worden ist, weil sie lesbisch war, sind diese Frauen dem deutschsprachigen Publikum wenig oder gar nicht bekannt. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass man sich hierzulande nicht gerne an Reporterinnen erinnert, die fassungslos deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager betraten und über die Verbrechen der Deutschen berichteten.
Eine dieser Vergessenen ist Martha Gellhorn. Sie wurde am 8. November 1908 in St. Louis geboren, studierte in Bryn Mawr, zog 1930 nach Paris und sieben Jahre später gemeinsam mit Ernest Hemingway in den Spanischen Bürgerkrieg. Bis zum Ende des Kalten Krieges war sie als Reporterin bei jedem großen internationalen Konflikt an vorderster Front dabei, was ihr den Spitznamen »Desaster Girl« einbrachte. Gellhorn beging 1998 im Alter von 90 Jahren in London Selbstmord.
Im Dörlemann-Verlag sind nun die Briefe der Journalistin und Schriftstellerin erschienen. Es sind Dokumente, die einen faszinierenden Einblick in das Denken und Fühlen der brillanten Kriegsreporterin gewähren. Leider fehlen Briefe aus den Jahren 1944 und 1945, als sie sich mit der US-Army von Italien aus gen Deutschland durchkämpfte und mit den alliierten Truppen in der Normandie landete. Gellhorn war es als Frau zwar nicht erlaubt, sich unter die kämpfenden Truppen zu mischen, doch das war ein Verbot, über das sie sich kühn hinwegsetzte.
Sie überschritt mit der US-Army den Rhein. In Gesprächen mit der deutschen Bevölkerung versuchte sie in Erfahrung zu bringen, was in den Leuten während der vorangegangenen zwölf Jahre vorgegangen sein mochte. »Niemand ist ein Nazi. Niemand ist je einer gewesen«, schrieb sie danach verbittert-ironisch in ihrem Text »Das deutsche Volk«, der in der auch in Deutschland erschienenen Reportagensammlung »Das Gesicht des Krieges« abgedruckt ist. »Es hat vielleicht ein paar Nazis im nächsten Dorf gegeben, und es stimmt schon, diese Stadt da zwanzig Kilometer entfernt war eine regelrechte Brutstätte des Nationalsozialismus. Um die Wahrheit zu sagen, ganz im Vertrauen, es hat hier eine Menge Kommunisten gegeben. Wir waren schon immer als Rote verschrien. Oh, die Juden? Tja, es gab eigentlich in dieser Gegend nicht viele Juden. Zwei vielleicht, vielleicht auch sechs. Sie wurden weggebracht. Ich habe sechs Wochen lang einen Juden versteckt. Ich habe acht Wochen lang einen Juden versteckt. (Ich hab einen Juden versteckt, er hat einen Juden versteckt, alle Kinder Gottes haben einen Juden versteckt.)«
»Man müsste es vertonen«, spottete sie. »Dann könnten die Deutschen diesen Refrain singen, und er wäre noch besser. Sie reden alle so. Man fragt sich, wie die verabscheute Nazi-Regierung, der niemand Gefolgschaft leistete, es fertig brachte, diesen Krieg fünfeinhalb Jahre lang durchzuhalten. Nach allem, was sie so von sich geben, hieß kein Mann, keine Frau und kein Kind in Deutschland den Krieg auch nur einen Augenblick gut. Wir stehen mit fassungslosen und verächtlichen Gesichtern da und hören uns diese Geschichten ohne Wohlwollen an und ganz gewiss ohne Achtung. Ein ganzes Volk, das sich vor der Verantwortung drückt, ist kein erbaulicher Anblick.«
Martha Gellhorn hat aus ihrer Verachtung für die Deutschen keinen Hehl gemacht. In den dreißiger Jahren hatte sie den Opfern der großen amerikanischen Depression ihre Stimme geliehen und das viel beachtete Buch »The Trouble I’ve Seen« herausgebracht. 1937 war sie nach Spanien gegangen und hatte sich für die Spanische Republik engagiert. Sie war dabei, als die Sowjetunion im Herbst/Winter 1939/40 Finnland bombardierte, und berichtete nach ihrem Einsatz in Deutschland noch aus China, aus Haiti, vielen südamerikanischen Ländern, und immer wieder aus dem 1948 gegründeten Israel. So schrieb sie auch über den Eichmann-Prozess. Als sie später gefragt wurde, ob sie aus dem zerfallenden Jugoslawien über den Balkan-Konflikt berichten wolle, musste sie aus Altersgründen passen.
Sie war keine Linke, sie war eine kämpferische Demokratin, die sich sowohl mit den McCarthys in den USA wie mit den Fellow Travellers der Sowjetunion anlegte. Sie war keine Feministin, sondern verstand sich als Reporterin, die einfach nur ihren Job machen wollte, statt sich »über den Frauenstandpunkt zu verbreiten«. Martha Gellhorn, Jahrgang 1908, war Kriegsberichterstatterin, als Oriana Fallaci noch in den Windeln lag. Der Kriegsfotograf Robert Capa, den Gellhorn in Spanien kennen gelernt hatte, hatte ihr den Rat gegeben, immer ihren eigenen Standpunkt zu vertreten. »Im Krieg musst du jemanden lieben oder hassen. Du musst Stellung beziehen, sonst hältst du nicht aus, was du siehst«, hatte Capa gesagt, und Gellhorn hielt sich daran. Ihre Reportagen waren stets parteiisch, ihr Stil war prägnant.
Doch ihr politischer und journalistischer Einsatz, das haben Privatbriefe so an sich, werden in dem Band »Martha Gellhorn. Ausgewählte Briefe« von Privatem verdrängt: Ihre Rastlosigkeit, die Sigrid Löffler im Nachwort kritisch hervorhebt, ihr burschikoses Wesen, ihre Appelle an Menschen, denen es schlecht geht, sich zusammenzureißen und nicht zu jammern – all das findet Löffler, die Martha Gellhorn ganz offensichtlich nicht mag, unschön. Sie übersieht dabei, dass man schon aus hartem Holz geschnitzt sein muss, wenn man Kampfeinsätze fliegt, bei der Betreuung von Sterbenden zur Hand geht oder im Schrapnellhagel am Boden entlangkriecht.
Im Buch aber werden die Privatperson und ihre Beziehungen zu Freunden und Freundinnen, zu Geliebten und zum Adoptivsohn vorgestellt. Und natürlich erhält das breiten Raum, was Gellhorn im Nachhinein als die größte Peinlichkeit ihres Lebens betrachtet hat, nämlich ihre kurze Ehe mit dem Schriftsteller Ernest Hemingway, den sie 1940 heiratete und von dem sie sich 1944 abwandte. Denn sie war es, die ihn beruflich überflügelte, als sie im Mai 1944 mit einem Schiff, das Dynamit geladen hatte, im britischen Liverpool ankam, sich von dort aus in die Normandie schmuggelte und ihre Texte in die USA kabelte, wo sie mit großem Interesse aufgenommen wurden.
Hemingway hat ihr ihren beruflichen Ehrgeiz und ihren Erfolg nie verziehen. Löffler, so scheint es, auch nicht so recht. Postum wird der Deutschenhasserin von deutscher Seite aus mitgeteilt, auch sie sei schließlich nur ein Mensch mit Fehlern und Macken gewesen.
Caroline Moorehead: Martha Gellhorn. Ausgewählte Briefe. Dörlemann Verlag, Zürich 2009, 420 Seiten, 24,90 Euro



 Nazis am Nil
Nazis am Nil