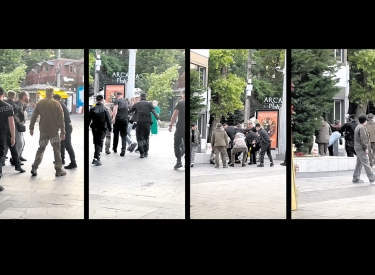»Das hat wenig mit Gesundheit zu tun«
Warum machen Sie sich in Ihrem Buch zum Anwalt der Dicken?
Die Hysterie um die angeblichen Folgen von Übergewicht und Adipositas hat bedenkliche Ausmaße angenommen. Zwei Drittel der Männer und mehr als jede zweite Frau seien zu dick, dicke Kinder stürben vor ihren Eltern, das Gesundheitssystem drohe unter den Folgekosten zusammenzubrechen, ja selbst die Zukunft des Sozialstaats sei bedroht. Gleichzeitig glaubt die Mehrheit der Bevölkerung, Übergewicht sei selbstverschuldet, die Dicken äßen nun mal zu viel und bewegten sich zu wenig. Durch ihr unverantwortliches Handeln entstünden Kosten, die dann am Ende alle tragen müssten. Hinzu kommt noch, dass Dicksein als unästhetisch gilt und dass es sich nicht verstecken lässt. Vorurteile gegen Dicke werden gesellschaftlich kaum geächtet. Jemanden in aller Öffentlichkeit als »dicke Kuh« oder »fettes Schwein« zu bezeichnen, wird nicht im Sinne der Political Correctness geahndet.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie vermeintlich Übergewichtigen die Einwanderung nach Neuseeland verboten wird, wie in den USA und in England den Eltern von dicken Kindern der Verlust des Sorgerechts droht und wie Japaner zur »Bauchmusterung« antreten müssen, um ihren Job nicht zu verlieren. Es wird nun von einer »Epidemie« der Fettleibigkeit gesprochen. Wie kam es dazu?
Zwischen 1980 und 2000 hat sich die Zahl der adipösen US-Amerikaner verdoppelt, Großbritannien hat eine ähnliche Entwicklung erlebt, und in vielen anderen Ländern wurde ein vergleichbarer Anstieg unterstellt, auch wenn er sich statistisch meist nicht nachweisen ließ. Die Weltgesundheitsorganisation hat Ende der neunziger Jahre, nicht zuletzt auf Drängen von Lobbyorganisationen der Pharmaindustrie, Übergewicht zur Epidemie erklärt. Dabei hat man sich verschiedener statistischer Tricks bedient. Zum einen hat man die Grenzwerte für Übergewicht und Adipositas so niedrig angesetzt, dass in allen Industrieländern die Bevölkerungsmehrheit als zu dick gilt. In den USA, die vorher eigene nationale Grenzwerte hatten, wurden so über Nacht mehr als 35 Millionen Menschen übergewichtig, und das, ohne ein Gramm zugelegt zu haben.
Zum anderen hat man aufgrund der starken Zunahme von Übergewichtigkeit in den achtziger und frühen neunziger Jahren unterstellt, diese Entwicklung setze sich linear fort, so dass schon bald die Bevölkerungsmehrheit adipös und fast alle Menschen übergewichtig seien, wenn man nicht schnellstens etwas unternehme. Die Folge war eine weltweite Hysterie, die Spitze des Eisberges sind die besagten Maßnahmen.
Behaupten Sie, es gebe gar keinen Anstieg der Fettleibigkeit, oder behaupten Sie, dieser sei gar nicht so schlimm?
Einen Anstieg gab es in den Industrieländern, auch in Deutschland. Allerdings ist er in vielen Ländern nicht so dramatisch verlaufen, wie häufig unterstellt wird. Selbst in den USA, wo statistische Erhebungen einen starken Anstieg zwischen 1980 und 2000 zweifelsfrei nachweisen, steigt die Zahl der Übergewichtigen und Adipösen seit der Jahrtausendwende nicht weiter an.
Sie behaupten, Diäten seien bestenfalls wirkungslos, schlimmstenfalls sogar schädlich, und Bewegung bringe auch nichts fürs Abnehmen. Ist das nicht eine bequeme Ausrede?
Kurzfristig abnehmen ist einfach. Das Gewicht zu halten, ist eine ganz andere Sache. Diejenigen, die versuchen, in kurzer Zeit viel Gewicht zu verlieren, haben am Ende meist mehr auf den Rippen.
Ernährungstipps in Büchern, Zeitschriften oder auch in Ratgebern, die von der öffentlichen Hand gesponsert werden, geben Alltags-Speisepläne aus, die sich nicht mehr von einer Dauerdiät mit minimaler Kalorienzufuhr unterscheiden: möglichst kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol, und am besten nur Obst und Gemüse. Wem, außer Herstellern von Schlankheitsmitteln, nutzt dieser »war on fat«, wie ihn George Bush tatsächlich genannt hat?
Vom Schlankheitswahn profitieren ganz verschiedene Industriezweige. Zum einen natürlich die Pharmaindustrie, die versucht, ihre Abnehmpillen an die Frau und zunehmend auch an den Mann zu bringen. Dann die Anbieter von kommerziellen Abnehmprogrammen wie Weight Watchers sowie unzählige Frauenzeitschriften, die ihre Seiten Woche für Woche mit den immergleichen Diätvarianten füllen. Und natürlich auch Teile der Lebensmittelindustrie. Die Hersteller von Light-Produkten etwa, die ihre gestreckte Butter und ihren verdünnten Joghurt häufig teurer verkaufen als das Original. Ironischerweise sind es nicht selten dieselben Konzerne, die mit dem Verkauf vermeintlicher Dickmacher wie Schokolade, Cola und Kartoffelchips erst reich geworden sind und sich dann eine Light-Sparte zugelegt haben. Ein Beispiel ist der weltweit größte Lebensmittelkonzern Nestlé, der sich vor kurzem den weltweit größten kommerziellen Diätanbieter Jenny Craig unter den Nagel gerissen hat. So lässt sich der Umsatz auch in einem im Wortsinn gesättigten Markt steigern.
Während man früher »der Hausfrau«, die nicht richtig kochen könne, die Schuld am Übergewicht der Kinder gab, ist jetzt eine neue Schuldige ausgemacht: die Hartz-IV-Mutter, die Unterschichts-Schlampe, die im Jogginganzug mit ihrer Brut faul vor dem Fernseher hockt und Fertigfraß in sich und ihre Familie hineinstopft. Wieso werden nun Essgewohnheiten als Klassenmerkmale stigmatisiert?
Übergewicht widerspricht den Idealen der Leistungsgesellschaft. Dicksein gilt als Symbol für falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, Sich-gehen-Lassen, Chips-Fressen, Glotzen, Computerspielen und Auf-der-Couch-Herumhängen. Übergewicht gilt als Folge »demonstrativen Konsums«, wie das im Soziologen-Deutsch heißt. Große Flachbildfernseher, DVD-Player, Playstation für die Kinder, Fast Food und Fertigpizza. Wer sein Geld so investiert, müsse sich nicht wundern, wenn aus den eigenen Kindern nichts wird und man auch selbst im Leben nicht weiterkommt.
Die von Abstiegsängsten geplagte Mittelschicht ist da disziplinierter, sie versucht noch mit dem schmalsten Budget, eine frisch zubereitete Gemüsesuppe auf den Tisch zu zaubern. Und rechnet dann der undisziplinierten Unterschicht mit gezücktem Zeigefinger vor, dass das alles eine Frage des Willens und der Prioritäten sei und mit Geldmangel nichts zu tun habe. Das hat wenig mit Gesundheit zu tun und viel mit dem Wunsch nach Abgrenzung. Denn dieser »bewusste« Konsum gilt als Nachweis von Leistungsbereitschaft und als Voraussetzung für den gesellschaftlichen (Wieder-)Aufstieg. Wo die Normalbiographie und das Normalarbeitsverhältnis zur Ausnahme werden und die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Produktion und Reproduktion fließend werden, ist jedes Konsumhandeln letztlich eine Investition in die Ich-AG. Wer seine employability ernsthaft fördern möchte, lässt deshalb schon morgens das Nutella im Schrank und greift lieber zur fettarmen Putenwurst.
Der Kampf gegen das Übergewicht von Kindern ist ein immer wieder gerne bemühtes Thema. Sie beschreiben, dass 15 Prozent aller Kinder als zu dick gelten, sich in manchen Altersgruppen aber schon 50 Prozent zu dick fühlen.
Von der gegenwärtigen Übergewichtshysterie sind dicke Kinder am meisten betroffen. Denen wird so lange eingeredet, dass sie keine Zukunft hätten, bis sie es am Ende selbst glauben. Besonders ärgerlich finde ich, wenn die Experten betonen, wie schlimm doch die dicken Kinder gehänselt würden. Als Lösung wird dann immer Abnehmen vorgeschlagen. Obwohl man mittlerweile längst weiß, dass das, von wenigen Einzelfällen abgesehen, sowieso nicht funktioniert. Man setzt die Kinder einem wahnsinnigen Druck aus und sorgt so dafür, dass sie schon im Kindergarten erfahren, dass sie, so wie sie sind, nicht in Ordnung sind. Anschließend wundert man sich darüber, dass dicke Kinder schon in der Grundschule in der Beliebtheitsskala ganz unten stehen.
Was halten Sie persönlich von »toughen« Männerkochmagazinen wie Beef?
Klar vertritt Beef ein tradiertes Männerbild. Männer brauchen Fleisch, scharfe Messer, scharfe Frauen und so weiter. Aber immerhin geht es da im Wesentlichen ums Kochen. Andere Männermagazine sind da viel aggressiver. Zum Beispiel Men’s Health. Das handelt wirklich in erster Line davon, Alpharüde zu werden, Karriere zu machen und nebenbei möglichst viele Frauen flachzulegen. Auffallend finde ich, dass es dafür heute offensichtlich nicht mehr ausreicht, coole Sprüche zu klopfen, schnelle Autos zu fahren und mit Kennermiene Hochprozentiges zu verkosten. Der erfolgreiche Mann von heute muss sich genauso wie die Karrierefrau einer körperlichen Askese unterziehen. Er muss die Kalorientabellen auswendig aufsagen können, den Kohlenhydratwert von Brötchen und Tomaten kennen und gutes Omega-3-Fett von bösem Omega-6-Fett unterscheiden. Statt Steaks und Whiskey gibt es deshalb in modernen Männermagazinen zuckerarme Trendlimonaden und viel Obst und Gemüse. Damit das nicht allzu sehr mit dem klassischen Rollenbild kollidiert, wird in die Trickkiste gegriffen: Obst und Gemüse etwa werden dem modernen Mann mit der Aussicht auf »verbesserte Samenproduktion« schmackhaft gemacht.
Wie kann man der von Ihnen skizzierten diskursiven Verschiebung, die die Kosten für Krankenversicherungen immer mehr privatisieren will und so die Finanzschwachen vorausblickend als undisziplinierte Fette stigmatisiert, die egoistisch das System für alle ruinieren, etwas entgegensetzen?
Es müsste ein Bewusstsein dafür geben, dass Gesundheit und Verhalten nur sehr bedingt etwas miteinander zu tun haben und dass Verhaltensweisen nicht immer frei wählbar sind. Wichtiger noch: Wohlverhalten darf nicht zur Voraussetzung für den Zugang zum Gesundheitssystem werden. Im Prinzip ist das nicht anders als bei Hartz IV. Lebensrisiken werden privatisiert, und nur noch bei angepasstem Verhalten wird die Daseinsfürsorge als Gnadenakt gewährt – und nicht länger als soziales Recht.


 Die Lichter gehen aus
Die Lichter gehen aus