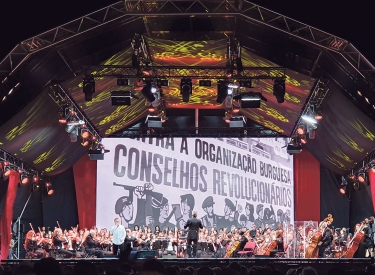Vergessen am Rande Europas
Der Wind pfeift durch das provisorische Zeltlager. Menschen stehen Schlange und warten darauf, sich unter einem alten Schlauch mit eiskaltem Wasser zu duschen. Sie leben in schlecht befestigten Zelten inmitten eines Olivenhains, denn das Auffanglager Moria ist hoffnungslos überfüllt. Abfälle und Fäkalien liegen herum, Toiletten gibt es kaum. Neben den Zelten ragt ein hoher Zaun mit Nato-Stacheldraht empor, dahinter ist Militär stationiert und sind weitere Flüchtlinge untergebracht. Es sieht aus, als handle es sich um ein Hochsicherheitsgefängnis. Spärliche Wohncontainer stehen dicht gedrängt hinter mehrreihigen Stacheldrahtzäunen. Doch das Lager beherbergt keine Kriminellen, sondern Menschen, deren einziges Vergehen der Wunsch nach einem sicheren und besseren Leben ist. Es ist ein »Hotspot-Camp« der EU auf der griechischen Insel Lesbos: ein Ort, an dem Tausende Menschen seit anderthalb Jahren mit völlig unzureichender Versorgung ausharren müssen.
Es ist Europas vergessene Krise. Einst war Lesbos das Eingangstor des Kontinents und beherrschte die Berichterstattung. Tausende Menschen retteten mit der Überfahrt auf die Insel ihr Leben. Die erprobten europäischen Abschottungsmechanismen versagten. Weder Militärschiffe noch Radargeräte konnten die Menschen aufhalten. Die Strände waren bedeckt mit Schwimmwesten und die Einwohnerinnen und Einwohner der Insel reichten den Ankommenden in spontaner Hilfsbereitschaft Decken, Wasser und Essen. Zahlreiche Menschen sammelten sich im Hafen der beschaulichen Küstenstadt Mytilini, um mit den Fähren weiter auf der Balkanroute zu reisen.
Doch mittlerweile ist von der Euphorie des Jahres 2015 nichts mehr zu spüren. Auf Lesbos materialisieren sich die Folgen der europäischen Abschottungspolitik: Die Grenzen sind geschlossen, die Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen wird auf die griechischen Inseln und in die Türkei verlagert. Die Insel ist zu einer Falle geworden. Über 6 000 Menschen sitzen hier fest und täglich kommen neue hinzu. Fast alle von ihnen sind gezwungen, in Lagern zu leben.
»Das Leben in Moria macht uns alle krank«, sagt Mohammad, ein junger Mann aus Syrien, der in Damaskus Architektur studiert hat. »Wir wachen morgens dicht gedrängt im Zelt auf. Es stinkt nach altem Fleisch. Ich ertrage es nicht, mich nicht richtig waschen zu können. Im Sommer ist es unerträglich heiß und stickig, im Winter eiskalt. Alles ist durchnässt. Wenn du morgens aufwachst, kannst du deine Glieder kaum bewegen. Und du bist bedeckt mit Ruß. Letzten Winter haben wir Pappe und Plastik verbrannt, um warm zu bleiben. Es ist, als wären wir keine menschlichen Wesen.« Mohammad musste eineinhalb Jahre auf die endgültige Bearbeitung seines Asylantrags warten. Er hasst es, bei Hilfsorganisationen um Decken und Kleidung bitten zu müssen, und fühlt sich zur Passivität verdammt. Er berichtet davon, wie sich Menschen in ihrer Verzweiflung selbst verletzten und es immer wieder zu Suizidversuchen komme, denn die Flüchtlinge seien den Bedingungen, die die EU geschaffen hat, schutzlos ausgeliefert. Auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen stellte einen drastischen Anstieg der Zahl psychischer Leiden bei Asylsuchenden auf Lesbos fest. Die NGO Save the Children berichtet, dass Selbstverletzungen und Suizidversuche bereits bei Kindern vorkämen. »Es ist so erniedrigend«, sagt Mohammad. »Morgens musst du früh aufstehen und dann stundenlang für ein kleines bisschen Essen anstehen, hinter Hunderten von Menschen, und trotzdem gibt es nie genug, um satt zu werden. Nach einigen Monaten verlieren die Menschen alle Hoffnung.«
Der junge Filmemacher Fridoon Joinda lächelt Mohammad hinter der Kamera zu und zeigt den Daumen nach oben. Er hat Mohammads Worte aufgezeichnet und legt zufrieden das Stativ seiner Kamera zusammen. Joinda ist selbst ein Flüchtling und weiß, was es bedeutet, über Monate stundenlang für Essen anzustehen. Er kämpft dafür, die Lebenssituation der Menschen auf der Insel öffentlich sichtbar zu machen. Zusammen mit seinen zwei Brüdern Fardin und Jalal floh er aus Afghanistan, weil die progressive Satiresendung seiner Familie der afghanischen Regierung und den Taliban ein Dorn im Auge war. Anfangs nur ausgestattet mit einem Handy, begann Joinda auf Lesbos Kurzfilme über die Lebenssituation von Flüchtlingen zu drehen. »Ich will einfach nur die Wahrheit zeigen«, sagt er. »Ich möchte erreichen, dass die Menschen in Europa nicht den großen Medien glauben. Flüchtlinge sind einfach nur Menschen, sie haben Talente, Emotionen und Träume. Aber im Lager werden wir behandelt wie Untermenschen.«
Einer der Hauptgründe für die verzweifelte Situation auf Lesbos ist das von der deutschen Regierung vorangetriebene Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei. Dieses sieht vor, dass alle Menschen, die nach dem 20. März 2016 die griechischen Inseln erreicht haben, in die Türkei zurückgeschoben werden – selbst wenn ihnen nach der Genfer Konvention ein Flüchtlingsstatus zuerkannt werden müsste. Bis ihre Verfahren abgewickelt sind, müssen sie auf den griechischen Inseln ausharren.
Joindas Dokumentarfilm »Sent to Their Deaths« zeigt, wie die idyllische Insel Lesbos durch das Abkommen für Menschen im Asylverfahren zu einem Freiluftgefängnis wird. Sie warten dort in wachsender Verzweiflung auf ihre Abschiebung. Einige Schutzsuchende werden pauschal wegen ihrer Nationalität während ihres gesamten Asylverfahrens in einem Abschiebegefängnis im Inneren des Lagers Moria inhaftiert. Nach mehreren Monaten werden die meisten von ihnen in die Türkei abgeschoben. Doch auch dort können sie der Inhaftierung nicht entfliehen. Alle Menschen, die nicht aus Syrien stammen, werden nach der Ankunft in sogenannten Rückführungszentren inhaftiert, von wo aus viele von ihnen abgeschoben werden. Selbst für Syrerinnen und Syrer soll es in der Türkei nicht sicher sein.
Doch es regt sich Widerstand unter den Flüchtlingen. Immer wieder gibt es auf Lesbos Protestmärsche und Hungerstreiks. Viele Asylsuchende entziehen sich dem Leben im Lager. Sie besetzen leerstehende Gebäude, in denen sie selbstorganisiert leben. Auch der Filmemacher Joinda lebte und arbeitete lange Zeit in einer alten Lagerhalle, die von Flüchtlingen und europäischen Unterstützerinnen und Unterstützern bewohnbar gemacht worden war. Aber auch dort sind die Lebensbedingungen ohne fließendes Wasser und Schutz gegen die Witterung alles andere als einfach und die Menschen leben in ständiger Angst vor Räumungen und Inhaftierungen.
Nun wird es langsam Winter, auch auf der griechischen Insel Lesbos am Rande Europas. Der Winter kann tödlich sein. Im vergangenen Jahr kamen im Lager Moria drei Menschen in schneebedeckten Zelten ums Leben. Eine Frau und ein junges Mädchen verbrannten vor den Augen ihrer Familien nach der Explosion eines Gaskochers. Auch diesen Winter leben Menschen in Moria in instabilen Zelten. Doch die Zuständigen bleiben untätig. Die griechische Regierung, die EU und die UN-Flüchtlingsbehörde UNHCR weisen die Verantwortung von sich. Bisher ist nicht zu erkennen, dass die kaputten Zelte ersetzt würden. »Auch diesen Winter wird es wieder Tote geben«, befürchtet Joinda. »Sie halten die Menschen gefangen, selbst wenn diese dabei sterben. Und niemand wird dafür zur Verantwortung gezogen.«



 Weil es kein Wasser gab
Weil es kein Wasser gab