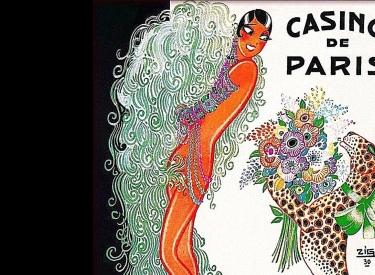Der lange Kampf gegen den Paragraphen 218
Die Proteste gegen das Abtreibungsverbot sind beinahe so alt wie der »Schandparagraph« selbst. Immer wieder protestieren Feministinnen und Linke gegen die teils drakonischen Strafandrohungen und für den Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Dabei standen sie ihrem Erfolg aber teilweise selbst im Weg.
Seit 150 Jahren steht der Abtreibungsparagraph 218 im Strafgesetzbuch, aber legal waren Schwangerschaftsabbrüche auch vorher nicht. Nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 wurde das neue Gesetz auf Grundlage verschiedener früherer Landrechte verfasst, die zum Teil drakonische Strafen wie bis zu zehn Jahre Zuchthaus im preußischen Landrecht, teilweise aber auch Straflosigkeit in der ersten Schwangerschaftshälfte wie im bayerischen Kriminalkodex für Schwangerschaftsabbrüche vorsahen. Die Paragraphen 218 bis 220 des Strafgesetzbuchs fielen unter die Rubrik »Verbrechen und Vergehen wider das Leben«. Die seit der Reichsgründung gültigen Paragraphen sahen bei Abtreibung eine Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren vor.
Zu seinem 150. Geburtstag sollte das Gesetz in seinen wohlverdienten Ruhestand geschickt werden. Das kann aber nur gelingen, wenn sich Feministinnen und Linke nicht erneut in Grabenkämpfe um Einzelheiten verwickeln.
Seit der Jahrhundertwende stritten sozialistische und bürgerliche Frauen mit dem Slogan »Dein Bauch gehört dir« gegen den »Unrechtsparagraphen«. Bereits damals argumentierten sie, dass restriktive Gesetze Schwangerschaftsabbrüche nicht verhinderten, sondern diese nur erschweren und riskanter machten, vor allem für arme Frauen. Vermögende ungewollt Schwangere könnten hingegen auch unter Bedingungen der Illegalität eher einen Arzt finden, der den Abbruch medizinisch sicher vornahm.
Der Kampf für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung war häufig mit der Kritik an der herrschenden kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaftsordnung verbunden und ging über die Forderung nach einer Freigabe von Schwangerschaftsabbrüchen hinaus. Der 1905 von Helene Stöcker gegründete Bund für Mutterschutz und Sexualreform forderte den freien Zugang zu Verhütungsmitteln und frühzeitige sexuelle Aufklärung. Der Einfluss der kirchlichen Frauenorganisationen führte zu heftigen Auseinandersetzungen im Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) zwischen konservativen und reformerischen Vereinen über den Abtreibungsparagrafen. Dennoch brachte der BDF im Juni 1909 eine Petition zur Reform des Paragraphen 218 in den Reichstag ein, die Straffreiheit und eine Fristenlösung forderte. Erfolg hatte diese Petition allerdings nicht.
Nach dem Ende des Kaiserreichs und der Gründung der Weimarer Republik 1919 konnten Frauen in den Reichstag gewählt werden. Die Proteste gegen den Paragraphen 218, gegen Klassenjustiz und die kirchlichen Moralvorstellungen flammten erneut auf. KPD, USPD und MSPD brachten verschiedene Gesetzentwürfe zur Liberalisierung oder Streichung des Paragraphen ins Parlament ein, eine Mehrheit fand jedoch keiner. Die konservativen Parteien waren stärker als die gespaltene Linke. Diese konnte lediglich erreichen, dass die Zuchthausstrafe 1926 in eine Gefängnisstrafe umgewandelt und 1927 die medizinische Indikation eingeführt wurde, die Abbrüche erlaubte, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr war.
Der kommunistische Arzt Friedrich Wolf veröffentliche 1929 das sozialkritische Drama »Cyankali«, in dem eine Arbeiterin an einer verpfuschen Abtreibung stirbt. Als er und seine Kollegin Else Kienle wegen gewerbsmäßiger Abtreibungen verhaftet wurden, kam es in ganz Deutschland zu Demonstrationen, Protestmärschen und Kundgebungen, auf denen der Freispruch der Ärzte und die Abschaffung des »Klassenparagraphen« gefordert wurden.
Mit Beginn des Nationalsozialismus 1933 fanden alle Aktivitäten gegen den Paragraphen 218 ein Ende. Bereits im Mai 1933 machte die NSDAP alle Reformen rückgängig, die Paragraphen wurden in ihrer alten Form von 1871 wiederhergestellt. Zusätzlich wurde nun auch die Werbung für Abtreibungsmittel bestraft. Die Nazis verschärften aber nicht nur das Abtreibungsverbot; das Erbgesundheitsgesetz von 1935 erlaubte eugenische Schwangerschaftsabbrüche, die auch unter Zwang durchgeführt wurden. Die Fortpflanzung von nach nationalsozialistischer Ansicht »minderwertigen Volksgruppen« zu verhindern, war jetzt Staatsziel.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs regelten die BRD und die DDR Schwangerschaftsabbrüche unterschiedlich. In der DDR wurde Anfang der fünfziger Jahre eine Indikationsregelung eingeführt, am 9. März 1972 trat fast pünktlich zum Frauenkampftag das »Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft« in Kraft. Abtreibung war nun innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate möglich.
In der BRD galt wieder der Paragraph 218, in der Fassung aus den zwanziger Jahren. Unter dem Slogan der sich in der BRD nach 1968 formierenden Neuen Frauenbewegung »Mein Bauch gehört mir!« beteiligten sich Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten an einer großen Bewegung: Sie sammelten Unterschriften, bezichtigten sich selbst, illegal abgetrieben zu haben, und organisierten Busfahrten zur Abtreibung bei ungewollten Schwangerschaften in die liberaleren Niederlande. Vertreter der Kirchen wandten sich entschieden gegen eine Liberalisierung.
Die vom Bundestag 1974 beschlossene Fristenlösung für die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft trat jedoch nie in Kraft, weil die Unionsparteien das Bundesverfassungsgericht anriefen. Dieses erklärte 1975 die Fristenregelung für verfassungswidrig, da das in Artikel 2 des Grundgesetzes garantierte Recht auf Leben auch für Föten und Embryonen gelte. Diese umstrittene Interpretation prägt die Abtreibungsdebatte in Deutschland bis heute. 1976 trat eine erweiterte Indikationslösung in Kraft, die Abbrüche innerhalb bestimmter Fristen erlaubte, wenn eine medizinische, eugenische, kriminologische oder eine Notlagenindikation vorlag. Die damit verbundene gesetzlich vorgeschriebene Pflichtberatung erschwert eine offene, qualifizierte Beratung. Sie wurde gegen die Proteste von Frauen und Beratungsverbänden eingeführt.
Als sich der Beitritt der DDR zur BRD anbahnte, galten in Ost und West unterschiedliche Abtreibungsgesetze. Eine erste Demonstration gegen die Ausweitung der restriktiveren westdeutschen Version auf Ostdeutschland fand bereits am 22. April 1990 vor der Volkskammer der DDR statt. Am 16. Juni 1990 demonstrierten in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn etwa 10 000 Menschen für eine ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Etwa 3 000 Personen versammelten sich gegen eine Liberalisierung. Zwischen der west- und ostdeutschen Frauenbewegung gab es viel Unverständnis und Befremden – zu unterschiedlich waren die jeweiligen Lebenswelten und Bezugssysteme. Die Übernahme der liberalen DDR-Regelung konnte nicht erreicht werden.
Am 1. Oktober 1995 trat das auch heutzutage noch geltende Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz in Kraft, das den Paragraphen 218 erneut reformierte. Das in der DDR geltende Recht auf Abtreibung wurde damit abgeschafft. Schwangerschaftsabbrüche stehen vielmehr weiterhin im Strafgesetzbuch. Abtreibungen nach medizinischen oder kriminologischer Indikation sind legal. Abtreibungen können außerdem trotz ihrer Rechtswidrigkeit straffrei bleiben, wenn die ungewollt Schwangere sich einer Pflichtberatung unterzieht und danach eine Bedenkzeit von drei Tagen bis zum Abbruch einhält. Die verpflichtende Beratung war vor allem für DDR-Frauen ein Schritt zurück. Diese Beratung soll zwar »ergebnisoffen« geführt werden, aber auch dem »Schutz des ungeborenen Lebens dienen«, zwei Ziele, die sich offensichtlich widersprechen. Seit einigen Jahren erregen die Probleme, die diese Rechtskonstruktion hervorruft, vermehrt öffentliche Aufmerksamkeit.
Zu seinem 150. Geburtstag sollte das Gesetz in seinen wohlverdienten Ruhestand geschickt werden. Das kann aber nur gelingen, wenn sich Feministinnen und Linke nicht erneut in Grabenkämpfe um Einzelheiten verwickeln. Eine Debatte darüber, ob bestimmte Strategien die einzelnen Frauen eher empowern oder ihre Entscheidungen moralisieren, wie sie Rona Torenz angeregt hat, ist angesichts der Aufgabe, das Recht auf Abtreibung zu erkämpfen, nicht besonders zielführend. Um eine gemeinsame erfolgreiche Strategien zur Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu finden, brauchen wir breite Bündnisse und eine Einigung auf diese Forderung.




 Straight Out of Gotham City
Straight Out of Gotham City