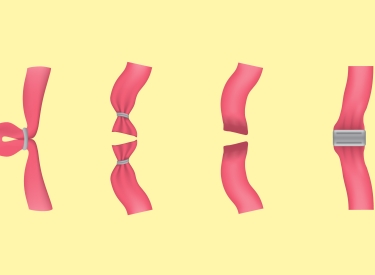Was linke Franzosen lesen
Andere Zeiten, andere Zeitungen? Es war eine bewegte Epoche, als der Philosoph Jean-Paul Sartre den Chefredakteursposten der neu gegründeten Tageszeitung Libération übernahm.
Am Anfang stand das linksradikale Journalistenbüro »Agence Presse Libération«, das 1971 nach einer Streikaktion für die Inhaftierten der Organisation Gauche prolétarienne (GP) begründet wurde, um zukünftig Kommuniqués besser veröffentlichen zu können. Es wurde ab Januar 1973 zum Zeitungsprojekt. Im folgenden Jahr 1974 besuchte der prominente Chefredakteur den inhaftierten Militanten Andreas Baader in Stuttgart-Stammheim. Die deutsche Presse schäumte und geiferte; Springers Welt erklärte, dass das ja kein Wunder sei, habe Sartre doch schon im Zweiten Weltkrieg »terroristische Sabotageaktionen« unterstützt. Die Zeitung meinte damit Akte der französischen Résistance gegen die deutsche Wehrmacht.
Mit ihren wilden Zeiten hat die heutige Libération aber abgeschlossen. Bereits 1981, zur Zeit der Amtsübernahme des sozialistischen Staatspräsidenten François Mitterrand, wurden die Ecken und Kanten abgeschliffen. Die Macht der oftmals chaotischen Vollversammlungen wurde gebrochen, Serge July ernannte sich zum »richtigen« Chefredakteur mit allen Vollmachten, und statt staatsfeindlicher Agitation war Hoffnung auf »Reformen« unter Mitterrand angesagt. Libération besitzt heute ein unscharfes linksliberalen Profil; lediglich die eine oder andere Reportage macht die Zeitung gelegentlich interessant.
In den frühen neunziger Jahren, mitten in der politischen Resignation, welche die Ära Mitterrand in weiten Teilen der Linken hinterließ, erfolgte die »zweite Geburt« der linken Wochen- und Satirezeitung Charlie Hebdo. Diese zur Hälfte aus Zeichnungen und zur anderen Hälfte aus Text bestehende antiautoritäre Zeitung hatte ihre erste große Zeit in den frühen siebziger Jahren gehabt. 1992 fanden sich einige der damaligen Blattmacher zwecks Wiederbelebung zusammen. Bis Mitte der neunziger Jahre gelang Charlie Hebdo ein rascher Wiederaufstieg. Mit einem kritischen und radikalen Profil zog die Zeitung sowohl ehemalige Leser an als auch ein jüngeres Publikum, das in Zeiten gesellschaftlichen Stillstands nach Bewegung Ausschau hielt. Zeitweise erreichte die Auflage den Spitzenwert von 90 000 Exemplaren. Charlie Hebdo hatte etwas zu bieten. Man erinnere sich nur an die »Petition zum Verbot des Front National« von 1995, die es binnen weniger Monate auf 150 000 Unterschriften brachte.
Unvergessen bleibt das Engagement der Redaktion gegen religiöse Fanatiker aller Couleur. So traf es auch die rechtskatholischen Abtreibungsgegner, die so genannten »commandos anti-IVG« (IVG steht für »freiwilligen Schwangerschaftsabbruch«). Im Herbst 1995 kündigte der Chefredakteur Philippe Val in einer Fernsehsendung zum Thema an, seinerseits commandos anti-bon Dieu (Anti-Gott) aufzustellen. Im Anschluss an die Sendung wurde er auf dem Parkplatz vermöbelt, doch der Publikumserfolg war gesichert.
Dennoch stieß das Projekt in den folgenden Jahren an seine Grenzen. 1999 kam es zum heftigen Streit. Anlass dafür war einerseits die überdeutliche Annäherung Philippe Vals und eines Teils der Redaktion an die Grünen. Der damalige Spitzenkandidat der in Paris mitregierenden Ökopartei bei den Europawahlen 1999, Daniel Cohn-Bendit, wurde im Blatt mit Gefälligkeitsinterviews hofiert. Das missfiel einem Teil der Mitarbeiter deutlich. Die Dissidenten hievten kurz vor den Europawahlen eine Wahlumfrage der Redaktion ins Blatt, der zufolge 36 Prozent für die trotzkistische Liste und nur 24 Prozent für die Grünen votierten. Andere Redakteure wählten gar nicht, aus anarchistischer Überzeugung. Die zweite, heftig diskutierte Streitfrage betraf die Haltung zum Kosovo-Krieg. Die Positionen Cohn-Bendits teilend, unterstützte Chefredakteur Val den »Krieg für die Menschen- und Minderheitsrechte«. Das sorgte für Stress und Ärger.
Der Konflikt endete mit dem Abgang profilierter Redakteure. Die Auflage fiel von gut 70 000 unter 60 000. Im Frühjahr 2000 betrieb Philippe Val einen Relaunch der Zeitung, der weniger Text und mehr Zeichnungen zur Folge hatte. Seitdem ist das Blatt sehr viel harmloser geworden; die Motive der Zeichnungen wiederholen sich zu oft, und einer der wichtigsten extjournalisten ist der Auslandsredakteur Gérard Biard. Er vertritt einen platten prowestlichen Antitotalitarismus; vor kurzem trat er für eine Stärkung der EU als progressivere Alternative zur US-Hegemonie ein. Freilich finden sich auch noch einige kritische Texte im Blatt, so von »Oncle Bernard«. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich Bernard Maris, der an der 68er-Universität Paris-VIII in Saint-Denis Ökonomie unterrichtet und ein »Anti-Lehrbuch für Wirtschaft« verfasst hat. In seinen Texten demoliert er oft bürgerliche Wirtschaftstheorien, dass es eine Freude ist.
Aus einer Abspaltung mehrerer Mitglieder der Pariser Redaktion entwickelte sich vor etwa zwei Jahren eine neue Zeitung, die radikale Gesellschaftskritik betreibt und in Marseille erscheint: die CQFD, was französischen Philosophie-Schülern als Kürzel für »Was zu beweisen war« (ce qui fut à démontrer) bekannt ist, aber in diesem Fall für das anspruchsvolle Programm steht: »Ce qu’il faut dire, détruire, découvrir …« (Was man sagen, zerstören, entdecken muss.) Dabei steht wohl das »Zerstören« des bestehenden Schlechten im Vordergrund, denn die Homepage wurde auf www. cequilfautdetruire.org getauft. Damit bringt es die Monatszeitung, von der inzwischen 15 Ausgaben erschienen sind, auf eine Auflage von 2 000 Exemplaren.
Zum Redaktionskollektiv gehört Olivier Cyran, der früher Redakteur von Charlie Hebdo war. CQFD begleitet seit Monaten intensiv die Bewegung der Arbeitslosen, Prekären und Intermittents und bietet dazu Berichte ebenso vom prekären Alltag wie von laufenden Kämpfen. Die Zeitung diskutierte heftig die Frage der Zukunft der Arbeit, etwa anhand von Pierre Carles’ Film »Attention travail!« (Vorsicht, Arbeit!), der die Verweigerung und das Modell des »glücklichen Arbeitslosen« anpreist. Ausgiebig betreibt das Blatt publizistische Kritik, so im Fall des Afrikaspezialisten von Le Monde, Steven Smith, der systematisch die Rolle Frankreichs beim Genozid in Ruanda oder die Verantwortung der ehemaligen Kolonialmacht für die Fehlentwicklungen Afrikas abstreitet oder herunterspielt.
Wesentlich umstrittener als CQFD ist das medienkritische Projekt PLPL (»Pour lire pas lu« »Lesen, was nirgendwo zu lesen war«), dessen Publikation in etwa zweimonatigem Rhythmus erscheint. Der Anspruch besteht darin, das aufzudecken, was andere Medien verschweigen. So knöpft man sich gern den Jet-Set-Intellektuellen Bernard-Henri Lévy vor, der in Frankreich auf allen Kanälen präsent ist. Oder man arbeitet in einem langen Dossier zum Thema »Die Medien und der Streik« heraus, dass die großen bürgerlichen Tageszeitungen wesentliche Fakten zur Streikbewegung des Frühsommers 2003 verschwiegen haben, und zeigt auf, wie die Zeitungen den Protest als Produkt »irrationaler Furcht und Demagogie« darzustellen versuchten. Dennoch ist PLPL auch unter Linken wegen des scharfen Tonfalls und unter die Gürtellinie zielenden Attacken auf bürgerliche Medienstars nicht immer beliebt.
Schließlich verfügt in Frankreich noch jede linke Strömung oder Organisation über ihre eigenes Publikationsorgan. So die Anarchokommunisten mit Alternative libertaire oder die beiden trotzkistischen Parteien mit Rouge oder Lutte Ouvrière. Während letztere reichlich dröge erscheint, trotz mitunter interessanter Betriebs- und Gewerkschaftsinformationen, wird Rouge durch die frechen Karikaturen des Künstlers Faujour aufgelockert, der mitunter auch für größere Zeitungen zeichnet. Die Anarchisten verfügen mit Le Monde libertaire über eine eigene Wochenzeitung, die auch an einigen Kiosken zu haben ist.
Während die kleinen linken Publikationen ohne Werbung auskommen müssen, kann die Tageszeitung der Parteikommunisten, L’Humanité, die im kommenden Herbst ihren 100. Geburtstag begeht, immerhin mit bescheidenen Kampagnen auf sich aufmerksam machen. Nachdem die Zeitung vor vier Jahren Bankrott zu machen gedroht hatte, stiegen größere Konzerne in den Verlag ein – wohl vor allem deswegen, weil sie sich davon Entgegenkommen bei Aufträgen in von den Kommunisten regierten Kommunen versprechen. Das Schwinden ihrer Leserzahl hat das nicht aufhalten können.