Schön und schäbig
Um einen Giotto hervorzubringen, schreibt Giorgio Vasari, genügte es, dass die Sterne günstig und die Säfte im rechten Mischungsverhältnis standen. Um einen Michelangelo hervorzubringen, musste sich der Herr persönlich herablassen.
»Da wandte der Lenker der Welten gnädig seine Augen zur Erde, und als er die Unmenge so vieler eitler Anstrengungen, die glühendsten Studien ohne Erfolg und den Eigendünkel der Menschen sah, der der Wahrheit viel ferner liegt als die Dämmerung dem Lichte, da beschloss er, uns von so vielen Irrtümern zu erlösen, einen Geist zur Erde zu senden, der allvermögend in jeder Kunst und jedem Beruf sei, der durch sich allein dartun könne, was Vollkommenheit der Kunst der Zeichnung sei in Entwurf, Umriss, Licht und Schatten, wodurch Gemälde Relief gewinnen, der die Bildhauerei nach richtiger Einsicht zu üben und durch Kenntnis der Baukunst Wohnungen bequem, sicher, gesund, heiter, nach richtigen Verhältnissen und reich an mancherlei Schmuck aufzuführen wisse.« (»La vita di Michelangelo«, 1550)
Einen Mann zu bilden, der allvermögend in der Kunst und in jedem Berufe ist und durch sich allein dartun kann, was Vollkommenheit der Zeichnung sei in Entwurf, Umriss, Licht und Schatten, wodurch Gemälde Relief gewinnen und wie die Bildhauerei nach richtiger Einsicht geübt wird, gelang dem Schöpfer und Lenker der Welten überaus gut. Aber, als ob ihn dieses Werk ein wenig erschöpft hätte, vernachlässigte er die im Grunde viel leichtere Aufgabe, den Künstler vom Eigendünkel zu befreien.
Auch diesen Makel beschreibt Vasaris Heiligenlegende, angefangen mit der unscheinbaren Bemerkung, Michelangelos Vater stamme, »wie man sagt«, aus dem edeln Geschlecht derer von Canossa. Sein Vater nicht, Michelangelo selbst erschwindelte diese Genealogie. Und auch seine erste künstlerische Großtat bestand in einem Schwindel: Er plagiierte alte Meister und vergaß auch nicht, die Bögen zu färben, damit sie alt aussahen. Michelangelo, der »rechtliche Mann«, der nicht »für einen Kaufmann gelten« wollte, unterwarf sich, um seinen gewaltigen Reichtum anzuhäufen, der Willkür der Päpste und dem eigenen Geiz. Mit übler Nachrede schlug er Konkurrenten aus dem Feld.
Vasaris Viten wagen den zum Scheitern verurteilten Versuch, Wunder und Wahrheit miteinander zu versöhnen, und haben damit allen späteren Künstlerbiografien, die jeweils das eine oder das andere, das Große oder das Kleinliche, sehen wollen, viel voraus. Die einen flechten den Lorbeerkranz, die anderen beleuchten die »dark side of genius«, und beide verfehlen das Ganze, das doch eine untrennbare Einheit von Schönheit und Schäbigkeit ist.
Sich selbst zeigt der Künstler im Kampf mit einer gewerbsmäßigen und gewissenlosen, verstockten und versteinerten Welt. Er will sich als den sehen, der aus der Welt gefallen ist, und ist es doch nur, weil er noch gewerbsmäßiger, noch gewissenloser, noch verstockter, noch versteinerter ist als sie. Sie duldet Geschäftemacherei, er betreibt nur sein eigenes Geschäft. Sie kennt nicht viel, er kennt nur sich selbst. Sie will ihn verstehen, versteht ihn aber nicht, er will noch nicht einmal seine Köchin verstehen.
So scheint die Frage, weshalb der größte und großzügigste aller Dramatiker, Shakespeare, so kleinlich sein musste, seiner Frau aus seinem bedeutenden Besitz nicht viel mehr als das »zweitbeste Bett« zu übermachen, weshalb Swift und Stein, die Unbeugsamen, sich, um einiger Vorteile willen, den trübsten Mächten ihrer Zeit beugten, weshalb Dante von Hass, Dürer von Ruhmsucht verkrebst, Ford ein Stinkstiebel, Fassbinder ein Menschenfresser war, leicht zu beantworten: Sie alle waren große Künstler. Sie konnten es sich erlauben, und Pablo Picasso never gets called an asshole. Doch das Problem liegt tiefer als die »droits du génie«.
In den Betrieb zu kommen, ist alles, wonach der junge Künstler strebt; im Betrieb zu sein, darüber jammert der alte. Tschechow zeigt das in seinem Drama »Die Möwe«, nachdem er die Lager geschieden hat, hier die gemütvollen Spießer wie der Wirkliche Staatsrat Sórin und die Vorstadtzyniker wie der Arzt Dorn, da die Künstler: an ihrer fiebrigen Eitelkeit erkrankte Phantasten wie Trepljów, von Dünkel, Geiz und Eiseskälte beherrschte Diven wie seine Mutter Arkádina oder Vampire wie Trigórin. Wenn die Künstler den Ruhm zur Genüge gekostet haben, liegt ihr Leben vor ihnen wie ein ausgezuzelter Wurstdarm: »Ich achte auf jeden Satz, auf jedes Wort, das wir sagen, und ich sperre alle diese Wendungen und Worte schleunigst in meine literarische Vorratskammer: vielleicht kann ich mal etwas davon verwerten!«, klagt der berühmte Schriftsteller. »Ich fühle, dass ich mein eigenes Leben aufzehre.«
Der Betrieb, das Werk verlangen, dass der Künstler von seiner Substanz abgebe, und hohl und trocken wird er dadurch, dass sie alles Schöne und Starke aus ihm gesaugt haben. So erklären sich vielleicht die Defizite gerade der produktivsten Künstler damit, dass sie besonders viel von sich verwertet und verwurstet haben; es ist nichts mehr an ihnen dran.
Nachdem er seine alles überstrahlende fünfte Symphonie längst vollendet, gerade letzte Hand an das herzzerreißende Adagio seiner sechsten Symphonie gelegt und die erste Fassung des »Te deum« skizziert hatte, erfuhr Anton Bruckner, dass sein Gegenspieler Brahms von den Universitäten Cambridge und Breslau zum Ehrendoktor ernannt worden war. Sogleich sandte er Bettelbriefe, Expertisen und Zeugnisse in alle Himmelsrichtungen, um ebenfalls ein Doktor des Ruhms und der Ehren zu werden.
Ein geringfügiges Detail vielleicht, das mich dennoch, als ich es Crawford Howies »documentary biography« des Komponisten (Lewiston usw. 2002) entnehmen musste, schockiert hat. Auch wenn einer Materialist durch und durch und jeder Illusion über die künstlerische Produktion ledig ist, erwartet er nach der fünften Symphonie zuerst einen Titanen, zuallerletzt einen Tropf. Doch nicht obwohl, sondern weil Bruckner gerade einige seiner erhabensten Stücke geschrieben hatte, gebärdete er sich würdeloser als ein Hofrat. Die Werke lassen sich durchaus auf ihre Autoren zurückrechnen – als Bilanzverlust.
Man könnte glauben, der große Künstler sei ein Revolteur, den allein seine Künstlerei von Verbrechen abhält (sodass er, wie Rimbaud, jene erst beenden muss, um diese zu begehen), dabei ist er, wie G.K. Chesterton gesagt hätte, ein »kosmischer Konservativer«, bloß mehr in die Händel und den Handel der Welt verstrickt als wir anderen. Was an der Kunst als Jenseitiges imponiert, hat ein ganz Diesseitiger geschaffen. Er besitzt die Midasgabe: Er macht aus Dreck Gold. Deshalb steht er immerzu mit beiden Beinen im Mist. Wer, wie Julien Benda, von ihm Vornehmheit verlangen wollte, verlangte zugleich, dass es ein Ende hätte mit aller Kunst.
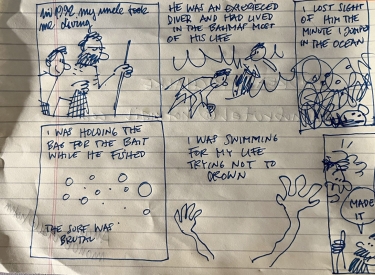



 Die Axt im Wald der Cancel Culture
Die Axt im Wald der Cancel Culture