Oma Hans fährt keinen Kettcar
Oma Hans
Von Roger Behrens
Wieso heißt die Band Oma Hans? Dass in den vergangenen Zeiten des Punkrock Bands Namen wie Angeschissen hatten, leuchtet wohl unmittelbar ein. Bereits mit dem poetischeren Namen Dackelblut wurde aber die kleine Punkwelt der direkten Aktion und direkten Assoziation überschritten und das absurde Universum betreten, das wir Moderne nennen.
Die Grenzen dieses Universums, das noch immer unsere Gegenwart ist, liegen allerdings in Zeiten, in denen vom Punk noch niemand etwas wusste, auch wenn die Kunst bereits früh den Impuls in sich aufnahm, der Jahrhunderte später einmal aus Punk eine Bewegung machen sollte. Anders gesagt: Der Beginn unserer Epoche bildet eine riesige Schwelle zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit, in deren Zentrum die Renaissance – wörtlich Wiedergeburt – liegt. Dante Alighieris »Göttliche Komödie« und dann Hieronymus Boschs »Garten der Lüste« sind der Anfang einer riesigen Verzerrung der neuzeitlichen Geschichte, die schließlich im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht: Die Moderne als Zeit der Hölle, und im Garten der Lüste wachsen die »Blumen des Bösen« von Charles Baudelaire – oder Blumen am Arsch der Hölle, wie es ein Jahrhundert später heißt.
»Das Leichenkleid«
»Ruf jetzt an – In die Hölle – Warum nicht – Teufel – Hallo? – Hallo? / Eine Frau – Etwas älter – Letzte Nacht – Ja, genau.«
Die Moderne ist die Hölle nicht nur wegen des geschichtlichen Terrors, den sie entfaltete. Die Moderne wird zur Hölle, weil sich das angeblich Neue als ewige Wiederkehr des Gleichen entpuppt: Alles schon dagewesen, alles ist dasselbe. Punk ist der Wandelname dieser Hölle: gegen das falsche Glücksversprechen der modernen Unterhaltungskultur. Dass Pop nicht mehr modern ist, dass das Neue in der Popkultur keine Zukunft hat, dass die Geschichte von Klassenkämpfen und Revolutionen sich in eine Geschichte von Moden auflöst, ist die Kritik, die Punk in seinem ersten Jahrzehnt, den Siebzigern, anmeldete: in der Kleidung, in der Musik, im Auftreten.
Dass diese erste Zeit des Punk übrigens mit der Postmoderne zusammenfällt, ist kein Zufall. Es ist der letzte Versuch einer ästhetischen Avantgarde gewesen, an die politische Avantgarde anzuschließen – Anarchie war das berechtigte Programm, auf das Kunst und Politik vereinigt werden sollten: Chaos wurde zum Synonym der einzig noch möglichen Ordnung der Zukunft. Und Punk ist der wiederholte Versuch, diese militante Ästhetik mit Mitteln des Kapitalismus durchzusetzen. Merchandise, Corporate Identity, Parolen, die als Reklame funktionieren: The Great Rock ‘n‘ Roll Swindle.
Aber auch der Punk war, ebenso wie der Surrealismus, der ihm historisch vorausging, eine bürgerliche Bewegung, die in letzter Instanz eine bessere bürgerliche Welt haben wollte. Wie beim Surrealismus ist das »Charakteristische dieser ganzen linksbürgerlichen Position ihre unheilvolle Verkupplung von idealistischer Moral mit politischer Praxis« (Walter Benjamin). Die Varianten von Hardcore und Postpunk sind Ausdruck einer Selbstkritik, ein Zerfallsprozess. Jede Punkband hat mindestens einen Song gemacht, in dem es heißt »Punk is dead« oder »Punk’s not dead«. Bei Oma Hans heißt das, im Sinne einer Dialektik im Stillstand, als die sich das Leben hier geriert: »Es ist der Kreisverkehr / Es ist das Eis das schmilzt / Es ist das arschverdammte Dasein / wo das Schweigen / Quält (fehlt).« Es ist die Wiederkehr des Gleichen, eben die Hölle, in der die Großmutter der Gewöhnlichkeit eingesperrt ist: Oma Hans. Und Gewöhnlichkeit ist Kampfbegriff, Forderung gegen die permanente Katastrophe des Alltags, gegen die Verklärung des Gewöhnlichen. »Es ist wie nach einem Urknall.« Und zwar jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, die dieses System weiter fortbesteht.
»Gummiwände«
»Eine Stichflamme reißt / Eine Schneise ins Volk / + ins Abendrot / Der Kampf fängt jetzt an / Doch Gott ist schon lange tot.«
Pop ist: aus Scheiße Gold machen. Das versucht auch die junge Subkultur. Doch dass ästhetische Scheiße auch politisch braun ist, ist ja nicht der schmähliche Verrat der jungen deutschen Volksmusik am Independent, sondern deren Logik. Der Popnationalismus bringt namenlose Bands hervor, nicht umgekehrt. Dummheit ist nicht die Ursache von Reaktion, sondern deren Resultat. Noch ist die Debatte nicht abgeschlossen, wie die radikale Linke damit kulturpolitisch umgeht. Blumfeld, noch immer persönlich haftend, weil das Private das Politische ist, setzen eine Stellungnahme ins Netz, mit der sie sich erklären (der Autor, das Künstlersubjekt will sich nicht vereinnahmen lassen).
Was passend im Schillerjahr als Unterschied zwischen naiver und sentimentalischer Dichtung bezeichnet werden könnte, haben Tocotronic versucht: Aktualisierung der deutschen Frühromantik, merkwürdig nietzscheanisch gegen jede Kritik der reinen Vernunft ausgespielt. (Die Zarathustra-Position unterscheidet zwischen Natur und Nation, weil Patriotismus nicht rockt, spießig ist; und während Blumfeld ihren Antinationalismus als urbanen Standpunkt präsentieren beziehungsweise sich in der Stadt verboten, wie auf dem Cover des letzten Albums, treten Tocotronic aus dem Busch hervor, aus der Dornenhecke des Dornröschenschlosses, vier Prinzen, die bereit sind, ein Königreich zu verraten.)
Aber wieso heißt die Platte »Peggy«? Punk kommt ohne Erklärungen aus. Er hat nichts zu sagen, nur zu zeigen. Wie das Cover von Oma Hans drittem Album: gewöhnliche Jugendliche. Und das, was Punk zu zeigen hat, sind weder Momentaufnahmen des beschädigten Ichs noch Märchenbilder aus Parallelwelten. Dafür nimmt Punk sich selbst nicht wichtig genug. Punk zeigt dieses Leben hier: die Nation als Hölle eben.
Das alte Punkprogramm ist jede Abkehr von Pathos, Verweigerung jedes Rettungsversuchs, ist also Slime, »Deutschland verrecke!« (Nebenbei: für die Aufnahme ist der Slime-Schlagzeuger Stephan kurzfristig für den verletzten Oma-Hans-Trommler Armin eingesprungen.) Oma Hans bewegen sich in dieser Tradition, reduzieren aber das Pathos noch mehr, indem sie nicht nur die Parole verweigern, sondern die Diskussion: »Rumpelstilzchen tanzt / Jetzt mit neuem Namen / Durch die Indiecharts / Und versteckt sich da.«
Rumpelstilzchen ist das Urmärchen der Kulturindustrie. Es hat drei Jahrzehnte gebraucht, bis der Punk sich von der Illusion, eine Bewegung zu sein, in die Strategie einer rücksichtslosen Haltung, die ohne Bewegung auskommt, verwandelt hat. Ein Prozess, der auch mit den Veränderungen der Musik- und Politszenen in Hamburg verbunden ist. 1992 erschien David Markeys Film »1991: The Year Punk Broke«; in Hamburg wurde daraus ein Weitermachen abgeleitet, und eine Band aus dieser Zeit nannte sich But Alive ...
Daraus wurden Kettcar, die in einem ihrer Songs sinnierten: »2002 the year Schwachsinn broke / Jenseits von cool und raus aus / Selbstmitleid / will Sätze, die sagen: Das war’s.«
Der Song hieß »Landungsbrücken raus« und das deutsche Feuilleton hatte bei seinem allgemeinen Lob der Band besonderen Gefallen an diesen Selbsterläuterungen gefunden.
Oma Hans freilich singen nun: »Das war’s« und fügen hinzu: »mit euch«. Gut anarchistisch heißt es bei ihnen: »Landungsbrücken sprengen / Depressive Anekdoten / Die keinem etwas helfen / Außer Geld.«
Prinzipiell gilt: Es ist ein Mythos, dass Punk musikalisch auf drei Akkorde verpflichtet sei. Punk als Haltung: Das sind in Hamburg Cpt. Kirk &., Superpunk, Kante, die Goldenen Zitronen und vor allem Knarf Rellöm, der diese politische Ästhetik geprägt hat. Natürlich sind Oma Hans Punkmusik, also laut, schnell, geradeaus. Jens Rachut, Andreas Ness und Armin haben in ihrer Biografie eben Dackelblut, Blumen am Arsch der Hölle, Kurt oder Kommando Sonnenmilch stehen. Außerdem Peta Devlin, Die Braut haut ins Auge und aktuell: Cow.
Wenn Punk Jazz wäre, dann müsste man »Peggy« Standard nennen; tatsächlich swingt die Platte, bewegt sich in tonalen Mustern, die an Bebop ebenso wie an Cooljazz erinnern. Punk ist, dass der Titel der Platte damit nichts zu tun hat. Peggy soll der Name einer Zimmerwirtin sein. Das ist gewöhnlich und gleichgültig. Das ist – im Vergleich zu den Albentiteln anderer Bands – berechtigt unprätentiös. So wie das Cover-Artwork: vorn und hinten zwei Gruppenfotos, Jungs und Mädchen, die mit leeren Blicken in die Kamera sehen, Sicherheit als Style und Irritation als Ausdruck. Als könnten sie ein Bild von ihrer Zukunft sehen: eine moderne Fassung vom Garten der Lüste, aber immer noch dieselbe Hölle.
Oma Hans: Peggy. Schiffen (Indigo)
Kettcar
Von Ulrich Kriest
Kettcar aus Hamburg haben viele Fans, in jeder Redaktion dieser Republik sitzt mindestens einer, selbst bei der FAZ am Sonntag, wo man sonst keine Gnade für selbstmitleidige Modernisierungsverlierer empfindet. Deshalb sind Kettcar jetzt der Hype der Stunde. Auch weil das Debüt-Album »Du und wieviel von deinen Freunden« mit seinen unzähligen Hits und geflügelten Worten 2002 nicht adäquat abgefeiert wurde, sich aber trotzdem wie geschnitten Brot verkaufte und der maroden Industrie eine Nase drehte.
Jetzt soll Gerechtigkeit nachwachsen, obwohl gerade Album Nummer zwei deutlich zeigt, dass Themen und musikalische Einfälle des Quintetts ausgesprochen überschaubar sind: Liebe, Enttäuschung und Betrug, pathetische Geschichten vom Erwachsenwerden, gesungen von Jungs, die längst aufgehört haben, sich für ihre »bloß noch gefühlte« Jugend zu schämen – und auch nicht für ihren mittelschnellen Emo-Rock mit obligatorischer Gitarrenwand. Das kann man kitschig und klischeehaft finden, aber die »Generation Krise« erkennt im »befindlichkeitsfixierten Aufstand« eine emotionale Perspektive.
Von »Wahrhaftigkeit« ist im Zusammenhang mit Kettcar gern die Rede. Der Rolling Stone befindet: »Sie beschreiben das Leben, das wir alle führen, kein besonderes. Sie erzählen von der Liebe und was da alles schiefgehen kann. Eine Menge. Und sie benutzen dafür Worte, die einem oft so bekannt vorkommen – wahrscheinlich, weil man sie schon mal ähnlich gesagt und gedacht hat.« Solche Dinge hat man vor langer Zeit einmal der Befindlichkeitslyrik einer Christiane Allert-Wybranietz (»Trotz alledem«) nachgerühmt – und das war nicht nett gemeint. Und so bekommen wir, was wir wohl verdient haben. Zum Beispiel Tränenzieher, in denen Frauen sich »Audrey Hepburn« heißen lassen müssen, während der Mann niedlich als tapsiger »Balu, der Bär« beschrieben wird.
»Frieden ist, wenn alle gleich sind / Sag´ an, was wir hier haben! / Das Leben, das wir leben / Geschützt im Schützgraben« – solche Banalitäten, mit reichlich Kloß-im-Hals-Stimme dahingeklampft, sollen wir als »kümmernde Songs« verstehen. So schreibt zumindest Thees Uhlmann von den Kettcar-Kollegen Tomte, der zudem weiß: »Kettcar sind vielleicht nicht elegant und cool, aber wenn man da hingeht, wohin die Songs von Kettcar gehen, ist cool und elegant eh unglaublich weit weg.« Wo Uhlmann Recht hat, hat er Recht. Im Rolling Stone heißt es dagegen leicht angeekelt: »Bei Licht betrachtet: Phrasen, mittlerer Rock. Aber es ist eher dunkel hier unten.«
Auffällig ist jedenfalls, dass den Kritikern die Vergangenheit von Kettcar besser aus der Hüfte kommt als deren Gegenwart. Mit ihrem Debüt holten Kettcar mit Gitarrenrock und originellen Texten, »mit emotionalem Kern« (Kettcar-Sänger Marcus Wiebusch) die mittlerweile Thirtysomethings gewordenen Karriereverweigerer genau dort ab, wo diese von den kleinbürgerlichen Kunstliedparvenüs Blumfeld und Tocotronic im Regen der Depression stehen gelassen wurden. War 2002 nicht das optimale Jahr, um irgendwann in der Nacht auf die Straße zu treten und sich zu sagen: »Und wenn das alles ist: okay. Nur schade, wenn man mehr erwartet.« Nein? Es war all die Jahre davor genauso scheiße und ist seither nicht besser geworden? Ja mei, sind wir denn hier bei den Fehlfarben?
Früher sang Marcus Wiebusch: »Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, in Empfindsamkeit vereint. Hier. Befindlichkeitsfixierter Aufstand, hetero und männlich, blass und arm, weil wir bleiben, wie wir waren und ›Feuer frei und weiteratmen‹, das gute Wissen ist nicht billig…« Das war Kettcar 2002: Der Indiespirit, das gute Wissen, die Fähigkeit, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden und Haltung Handlungen folgen zu lassen. Schließlich gilt: »Wer bei 10 noch steht, hat Recht.« Oder: »Wir waren die Ersten, die kamen, die Letzten, die gingen. Verschlafen in der S-Bahn sitzen.«
Kettcar sind ein schwer romantisches Jungsding, so eine Art Cliquenwirtschaft, und erinnern mitunter an Tilman Rossmys ehemalige Band Regierung. In den Texten von Wiebusch geht es um Wut und Würde, um Grenzenziehen und Weitermachen, die Musik dazu scheut die Hymne nicht und kennt wenig mehr als die Dramaturgie des Laut und Leise von Hüsker Dü / Dinosaur Jr.. Wiebusch hat sich die Identifikationsqualität seiner Texte in der Kultband But Alive erarbeitet, deren bestes Album trug den Titel »Hallo Endorphin« und fand in der meinungsbildenden Musikpresse nicht statt, weil die Band sich über die Adressaten dieses intellektuellen Popdiskurses lustig machte (»Deine beknackten Freunde mit viel zu viel Zeit«). Neuerdings schwärmt Spex mit Pennälerpoesie jedoch von Kettcar: »Wer mies drauf ist, hört Hoffnung, wer auf der siebten Wolke schwebt, möchte die achte erklimmen, wer ratlos ist, schwört nach dieser Platte auf das Morgen. Wundervolle Momente sind das.«
Kettcar ist definitiv eine Ü-30-Party. Als mittelreifer Mann darf man sich repräsentiert fühlen von all den kleinen, ironiefreien und gerne auch mal pathetischen Geschichten über Verlierer und Verweigerer, die ihr Überleben in Niederlagen mit etwas Würde und ausgefuchsten Distinktionsstrategien meistern. Und jetzt kommt »Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen« und hält (Über)Lebensmittel bereit mit Sätzen wie »Ein Volk steht auf, na toll, bei ALDI brennt noch Licht«, der unausweichlichen Gitarrenwand und dem Refrain: »Nur, weil man sich daran gewöhnt hat, ist es nicht normal, nur weil man es nicht besser kennt, ist es nicht – noch lange nicht egal!« Das neue Album ist das alte Album, der Refrain von »Die Ausfahrt zum Haus deiner Eltern« ist der Refrain von »Landungsbrücken raus«. Finden wir das doof? Gegenfrage: Hatten die Smiths nicht auch nur zwei Songs? Den Langsamen und den nicht ganz so Langsamen?
Beim Stuttgarter Konzert Mitte Februar jedenfalls wurde viel gesungen. Mitgesungen. Rührend. Hunderte Jungs jeden Alters, die ganze Songs mitsingen können und wollen. Seelenverwandte, die ihren Frieden noch nicht gemacht haben, die »Nein!« sagen. »Nein!« zum Erwachsenwerden und »’ne geile Zeit« dabei haben. Wie die Kids bei Juli, Silbermond und Wir sind Helden! In Befindlichkeit vereint. Hätte man seine Freundin oder seine Frau mitgenommen auf dieses Konzert, hätte man hinterher einiges erklären müssen. Aber Mann ist ja nicht blöd, Kettcar sind schließlich eine Band für uns Männer, und deshalb heißt es bei ihnen wie in John-Ford-Country: »Das Gute an schlechten Zeiten, Pferde satteln, weiterreiten!«
Kettcar: Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen. Grand Hotel van Cleef (Indigo)
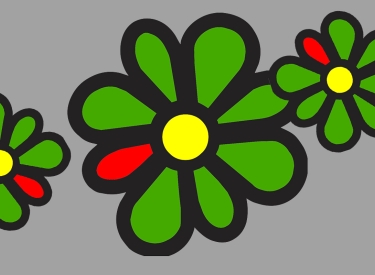
 Suche beendet
Suche beendet

