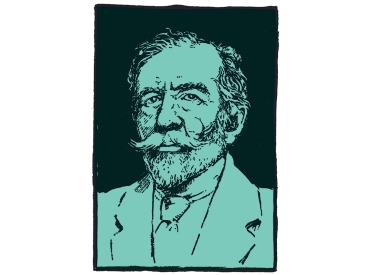Buddha, Sex & Judentum
Is this what you wanted, a house that is haunted by the ghost of you and me«, singt Leonard Cohen in dem Song »Is This What You Wanted« auf seinem 1974 erschienenen Album »New Skin for Old Ceremony«. Gespenster bevölkern das lyrische Werk und die Songtexte Cohens, Geister der Vergangenheit, die in unzähligen Songs von ihm beschworen werden. Solche Gespenster verfolgen das lyrische Ich im Song »The Future« auf dem gleichnamigen Album von 1992. Darin sehnt sich Cohen in eine Vergangenheit zurück, in der die Zukunft noch ein utopisches Versprechen sein konnte: »Give me back the Berlin wall«. Denn von der Gegenwart aus betrachtet birgt die Zukunft nur noch Elend und Tod: »There’ll be phantoms/ There’ll be fires on the road/ And the white man dancing./ The blizzard of the world/ Has crossed the threshold and it has overturned/ The order of the soul«.
Auch das Werk »Marx’ Gespenster« des französischen Philosophen Jacques Derrida, das zur gleichen Zeit mit Cohens Album »The Future« erschien, attestiert der Gegenwart eine Sehnsucht nach der verlorenen Vergangenheit und beschäftigt sich mit den Gespenstern der Vergangenheit, die über den Verlust eines Zukunftsversprechens trauern. Das »Ende der Geschichte«, von der das Feuilleton nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sprach, ließ Philosophie und Popkultur zugleich einen Blick zurück und einen nach vorne werfen, um die Gegenwart in den Griff zu bekommen.
Cohen hat mit seinen Songs voll düsterer Metaphern und lyrischer Bilder auch sehr genau auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, die er mit Melancholie und Sarkasmus kommentierte. So beschreibt Cohen in dem Stück »The Future« den Verlust eines Zukunftsversprechens und verband Motive aus der Mythologie und Religion mit Sexualität und Realpolitik. Er singt: »I’m the Jew who wrote the Bible«.
Die melancholischen Gespenster sind wichtige Figuren in Cohens Songs und literarischen Texten. Sie vereinen Melancholie mit einem rebellischen Moment: Gespenster sind dazu verdammt, niemals zur Ruhe zu finden. Für dieses Getriebensein findet Cohen eine Sprache der Melancholie. Gespenster sind gleichzeitig auch Rebellen, sie lehnen sich auf gegen die Vergänglichkeit, gegen die Idee einer Welt, die nur auf das Materielle Wert legt, die das Spirituelle, Religiöse und Mystische an den Rand drängt. Diese doppelte Funktion des Gespenstes ist in zahlreichen seiner Songs spürbar. Es geht um Verlust, um Trauer, um die Suche nach etwas Unbestimmtem, nach der Liebe, nach einem Zufluchtsort; es werden Sehnsüchte beschrieben und die innere Zerrissenheit des Künstlers – zerrissen zwischen Weltlichkeit und Spiritualität.
Cohen hat auch immer wieder provoziert. Er spricht oftmals in einem einzigen Song über so unterschiedliche Themen wie Sexualität, die Shoah, den Antisemitismus in Kanada, es geht um Drogen, Begehren und Liebe. Etwa in seinem Gedicht »Liebende« aus seinem ersten Gedichtband »Let Us Compare Mythologies« von 1956, auf Deutsch unter dem Titel »Blumen für Hitler« 1971 im März Verlag erschienen: »Im ersten Pogrom trafen sie sich/Hinter den Ruinen ihrer Häuser –/Sanfte Händler tauschten ein: ihre Liebe/Gegen eine Geschichte voller Verse./Und bei den heißen Öfen/Erschwindelten sie sich listig einen/Kurzen Kuss, ehe der Soldat kam/Um ihr die Goldzähne auszuschlagen./Und im Feuerofen dann/Als die Flammen höher flammten,/Versuchte er, ihre brennenden Brüste zu küssen/Als sie im Feuer verbrannte«.
Der kanadische Lyriker Eli Mandel unterstellte Cohen, er sei besessen von dem Motiv des Konzentrationslagers, worauf dieser antwortete: »Nun, ich wünschte, sie ließen mich heraus.« Die Geschichte hielt Cohen gefangen, seine eigene Biographie war eng verknüpft mit der Geschichte des Judentums des 20. Jahrhunderts, und diese Geschichte drang immer wieder, Gespenstern gleich, an die Oberfläche seines Werks.
Der Ursprung dieser jüdischen Gespenstergeschichte hat mit Cohens familiärem Hintergrund im frankokanadischen Montreal zu tun. Dort hatte sich im 19. Jahrhundert eine sehr spezifische Form der jüdischen Diaspora entwickelt, die anders als im Nachbarland USA nicht Teil der kanadischen Mehrheitsgesellschaft geworden war. Hier wurde ein orthodoxes, an der osteuropäischen Herkunft der meisten kanadischen Juden orientiertes Judentum gepflegt. 1934 wurde Leonard Norman Cohen als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie geboren. In seinem autobiograhischen Roman »Das Lieblingsspiel« von 1963 erzählt Cohen von der Familie Breavman, mit der er ironisch überspitzt seine eigene Familie und deren zentrale Rolle für das kanadische Judentum darstellt: »Die Breavmans haben beinahe alle Einrichtungen gestiftet und geleitet, die die jüdische Gemeinde von Montreal zu einer der einflussreichsten der Welt gemacht haben. In der Stadt erzählte man sich diesen Witz: Dass die Juden das Gewissen der Welt sind und die Breavmans das Gewissen der Juden.« Und weiter heißt es: »Vor zehn Jahren hat Breavman den Kodex der Familie zusammengetragen: Jeder Kontakt mit Unbeschnittenen gilt als Übertretung. Wir trinken weniger als ihr und haben die Zivilisation lange vor euch entdeckt, ihr mieses, blutrünstiges Säuferpack.«
Die Cohens gehörten zur Gründergeneration der jüdischen Gemeinde von Montreal. Leonard Cohens Vater Nathan, ein Ingenieur und Textilkaufhausbesitzer, war ein Urenkel von Lazarus Cohen, der als Reb Le-izer an einer Rabbinerschule in Litauern Karriere gemacht hatte, sich dann aber 1869 für die Übersiedelung nach Kanada entschied, wo er ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde. Leonard Cohens Großvater Lyon Cohen gründete die einflussreiche Zeitung The Jewish Times und wurde mit nur 35 Jahren der jüngste Vorsitzende der damals größten Synagoge Kanadas. Und Cohens Vater Nathaniel wurde Unternehmer, er starb bereits 1944, als Cohen gerade mal neun Jahre alt war. Tod und Verlust ziehen sich auch aufgrund dieser Erfahrung als Motive durch Cohens Werk.
Auch mütterlicherseits spielte die jüdische Religion eine wichtige Rolle. Cohens Großvater Solomon Klinitsky-Klein war ein in Kanada bekannter Rabbiner, der 1923 mit seiner Familie aus Polen nach Montreal gekommen war. Die familiäre Migrationserfahrung war somit noch sehr frisch, und Cohens Mutter Masha sang ihrem Sohn oft jiddische und polnische Lieder vor, die ihn, wie Cohen in einem Interview erklärte, sehr geprägt haben. So wurde die Erfahrung des Verlusts der osteuropäischen Heimat, der Verfolgung und Ausgrenzung an die nächste Generation weitergegeben. Auch wurde die Sehnsucht nach Europa und nach der Gemeinschaft des jüdischen Lebens im Schtetl wachgehalten.
Diese Sehnsucht spiegelt sich in Cohens Hommage an den osteuopäisch-jüdischen Künstler schlechthin: Marc Chagall, dem er das Gedicht »Out of the Land of Heaven« gewidmet hat, in dem ein Blick auf das Schtetl aus dem Himmel hinab beschrieben wird. Ein zentrales Motiv in der Kunst Chagalls war die Idee des schwebenden Menschen, der sich über die Anstrengungen des Lebens im Schtetl und die niederdrückende Erfahrung des alltäglichen Antisemitismus erhebt. Es bedeutete eine Errettung des Juden als Luftmenschen, während das Schweben gleichzeitig deutlich machte: Den Juden kann jederzeit der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Die Hoffnung, den Zuschreibungen der Mehrheitsgesellschaft zu entkommen, zu entschweben und das Leid in die Poesie und Musik zu überführen, trieb auch Cohen um. Er hat sich intensiv mit Klischees und Stereotypen des Jüdischen beschäftigt, so beispielsweise in seinem Gedicht »Genius«, in dem all jene Zuschreibungen aufgelistet werden, mit denen er als Jude umzugehen hatte: »Für dich/will ich ein Bankjude sein/ und zugrunde richten/einen stolzen alten Jägerkönig/und enden sein Geschlecht./Für dich/will ich ein Broadwayjude sein/und in den Theatern weinen/nach meiner Mutter/und Sonderangebote handeln/unterm Ladentisch./Für dich/will ich Dachaujude sein/und mich niederlegen im Kalk/mit verrenkten Gliedern/und maßlosem Schmerz/den kein Mensch begreifen kann«.
Cohen hat Ausgrenzung immer wieder zu spüren bekommen, gerade auch aufgrund der spezifischen Situation des Judentums in Kanada, wo sich einerseits zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch jüdische Einwanderer aus Osteuropa Jiddisch zur am dritthäufigsten gesprochenen Sprache entwickelt hatte und es auch heute noch eine Jiddisch sprechende Gemeinde gibt. Die jüdische Bevölkerung wurde aber niemals wirklich in die bestehende Gesellschaft integriert.
Diese Separierung der jüdischen Bevölkerung von der kanadischen Mehrheitsgesellschaft hatte zur Folge, dass osteuropäische jüdische Traditionen als wichtiger Teil der kanadisch-jüdischen Kultur weiterlebten und insbesondere das orthodoxe Judentum in Kanada am stärksten vertreten war. Diese Prägung und Erziehung spiegelt sich in den tiefreligiösen Texten Cohens. Wie kaum ein anderer Musiker hat er die religiösen Aspekte des Judentums zum Thema seiner Songs gemacht, etwa in »Who by Fire« von 1974, der auf der Liturgie für die Feiertage Rosh Hashana und Yom Kippur basiert: »And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who by common trial«.
Eine Folge der Ausgrenzung von Juden in Kanada war auch, dass die Gemeinde bis 1945, insbesondere im frankophonen Quebec, mit offenem Antisemitismus konfrontiert war, der die Abgrenzung von der restlichen Bevölkerung noch verstärkte. Nach 1945, als die Gemeinde von Montreal durch den Zuzug von Holocaustüberlebenden weiter angewachsen war, ließ der offene Alltagsantisemitismus im Angesicht der Shoah zwar nach, aber spätestens seit den ersten Bombenanschlägen der militanten Separationsbewegung »Front du Libération du Québec« Mitte der Sechziger, die sich gegen die nichtfranzösischsprachigen Minderheiten richtete, fühlten sich viele Juden in Montreal und Quebec nicht mehr sicher. Viele zogen nach Ontario, die nächstgelegenen Provinz Kanadas. Die kanadischen Juden in Québec wurden so zu Opfern eines Konflikts zwischen dem anglophonen und dem frankophonen Teil Kanadas. In dieser Zeit verließ auch Cohen das Land in Richtung Europa, behielt in Montreal zwar ein Haus, in dem er aber nicht mehr für längere Zeit leben sollte.
Zunächst ging Cohen nach Griechenland, bevor er Ende der Sechziger nach New York zog. Er hatte zur Zeit seines Wegzugs bereits mehrere Gedichtbände und zwei Romane veröffentlicht und hat sich zeit seines Lebens immer zuerst als Lyriker und erst in zweiter Linie als Musiker gesehen. Während viele andere seiner Generation ihr künstlerisches Erweckungserlebnis im Rock’n’Roll eines Elvis Presley hatten, war für Cohen der spanische Dichter Federico García Lorca wichtig. Bald aber entdeckte Cohen mit der Popkultur etwas für sich, das er anderswo nicht finden konnte: eine hybride Kunstform, eine ortlose Kultur voller Unruhe und ohne Verwurzelung, voller Zitate und Bezüge zur Hoch- wie Volkskultur. Pop war für ihn eine Form von Kultur, die einen Raum bieten konnte, der frei war von den Zuschreibungen, die er in Gedichten wie »Genius« aufgelistet hatte.
Ende der Sechziger wurde er Musiker, um für seine Gedichte ein größeres Publikum zu finden und nicht mehr auf das Erbe seines Vaters, von dem er lange noch leben musste, angewiesen zu sein. Sehr spät für einen Popmusiker, mit 33 Jahren, veröffentlichte er 1967 sein Debüt »Songs of Leonard Cohen«, mit dem er aus der Nische des verkannten Lyrikers – seine Bücher erschienen in winzigen Verlagen in kleinen Auflagen – zu einem gefeierten Star wurde. Bereits dieses Debütalbum enthielt mit »So long Marianne«, und vor allem »Suzanne« zwei seiner größten Erfolge. Dass er mit seinen Texten voller Verlusterfahrung, jüdischer Mystik und sexuellen Sehnsüchten einen solchen Erfolg hatte, verwundert bis heute. Faszinierend an Cohen sind vor allem die Widersprüchlichkeiten seiner Texte, das Pendeln zwischen expliziter Sexualität und dem Versinken in Religiosität und Spiritualitiät. In seinen Bezügen auf das Judentum, in den Aneignungen jüdischer Tradition, Religion und Kultur hat er stets versucht, das Judentum in der Gegenwart zu erden und auf die ihn umgebende Welt zu beziehen. Als Musiker hat er immer wieder versucht, über seine Bezugnahme auf jüdische Motive eine Kritik an politischen Entwicklungen der Gegenwart zu üben, wenn auch oft subtiler als die Protestsänger seiner Generation. So hat Cohen etwa in seinem Song »The Story of Isaac« von 1969, das die alttestamentarische Geschichte der Prüfung Abrahams durch die Opferung seines Sohnes aufgreift, einen Text verfasst, der als Song gegen den Vietnam-Krieg interpretiert werden konnte: »Then my father built an altar/He looked once behind his shoulder/He knew I would not hide/You who build these altars now/To sacrifice these children/You must not do it anymore«. Aber während der Song von vielen Kriegsgegnern der Generation der Achtundsechziger als Teil der Protestkultur angesehen und Cohen als politischer Sänger eingemeindet wurde, hat sich der Künstler immer wieder gegen solche Vereinnahmungen gewehrt. In einer Ansage während eines Konzerts in den Siebzigern stellte er dem Song die Worte voran: »Dieses Lied richtet sich an Menschen, die glauben, das Recht zu haben, die Jungen für einen bestimmten Zweck zu opfern, den sie als heilig oder richtig ansehen. Es ist ein Lied für diese jungen Menschen, aber auch für diejenigen, die sich mit mir gegen diese Jungen stellen. Denn ich will nicht Teil irgendeines Programms sein. Ich möchte meinen Namen nicht am Ende irgendeines Manifestes sehen.« Er verweigerte sich eindeutigen Aussagen, wollte sich von niemandem vor den Karren spannen lassen, weder in politischer, noch in religiöser Hinsicht. Vielen waren seine Songs zu religiös, für religiöse Juden waren sie wiederum sexuell zu explizit, für die Hippie-Kultur zu düster und schwer. Dennoch wurde er gehört, verkaufte Millionen Alben, vielleicht gerade weil er zwischen allen Stühlen saß und dabei virtuos mit Zitaten der christlichen und jüdischen Kulturgeschichte hantierte, in den letzten drei Jahrzehnten seines Lebens auch mit solchen des Buddhismus, mit Verweisen auf die Literaturgeschichte und die ihn umgebende Gegenwarts- und Protestkultur der Siebziger, ohne sich als Teil derselben zu sehen.
So sehr Cohen das jüdische Leben in der Diaspora auch geprägt hat, wurde ihm dennoch mehr und mehr, auch aufgrund der eigenen Erfahrungen des spezifisch kanadischen Antisemitismus, die Bedeutung Israels für das Judentum als möglicher Zufluchtsort bewusst. Für dieses gelobte Land gab er auch die Verweigerung der politischen Eindeutigkeit auf. Im September 1973 hielt er sich länger in Israel auf, und als im Oktober des gleichen Jahres der Yom-Kippur-Krieg begann, unterbrach er eine Tour in Griechenland und reiste nach Israel, um zur Unterstützung der Soldaten zu singen. Die im Jahr darauf veröffentlichte Platte »New Skin for Old Ceremony« ist geprägt von dieser Erfahrung. Der bereits erwähnte Song »Who by Fire« ist geprägt von einer Liturgie für Yom Kippur, die unter anderem denjenigen gewidmet ist, »die vor ihrer Zeit sterben werden«. Weiter heißt es im für Cohen so zentralen Gebet namens »Unetane Tokef«: »Für die, die durch Feuer oder durch Wasser sterben werden, durch die Gewalt von Menschen, durch Hunger oder Durst, durch Katastrophen, Seuchen oder Hinrichtung.« »Who by Fire« ist ein Lied des Gedenkens, ein Lied der Einkehr und des Nachdenkens, gespeist aus Cohens biographischer Erfahrung, als er während des Yom-Kippur-Kriegs Israel besuchte und mit den Soldaten der IDF Zeit verbrachte.
Vom selben Album stammt das Lied »Lover Lover Lover«, bei dem es sich, anders als der Titel suggeriert, um kein Liebeslied handelt, sondern um eine Zwiesprache des lyrischen Ichs mit Gott, die mit den hoffnungsvollen Worten endet: »And may the spirit of this song/ May it rise up pure and free./ May it be a shield for you/ a shield against the enemy.« Mehr als seine Musik konnte Cohen zur Unterstützung Israels nicht beitragen, dennoch war er erfüllt von der Hoffnung, dass auch dieser Beitrag eine eigene Kraft entfalten und zu einem schützenden Schild vor dem Feind werden kann.
Nicht zuletzt wollte Cohen zeigen, dass das Judentum mehr ist als die Summe seiner Leiden, seiner Verfolgung und Vernichtung, sondern auch ein lebendiger Teil der globalen Popkultur. Musiker wie Cohen, aber auch Bob Dylan oder Lou Reed, haben mit ihren Songs auch an einem neuen Bild des Judentums gearbeitet, an einem Judentum, das mit Identitäten spielt und dabei gleichzeitig die Geschichte des 20. Jahrhunderts in sich aufnimmt, das im verspielten und ortlosen Moment der Popkultur eine Chance wahrgenommen hat, neue Formen jüdischer Identität zu entwickeln. Dabei ging es auch darum, neue Formen des Gedenkens zu entwickeln, um jüdische Tradition und Kultur in die Gegenwart zu überführen, lebendig werden zu lassen und so stets neue Generationen mit diesem Erbe in Berührung zu bringen, einem Erbe, das eben beides ist: Verfolgung aber auch eine Überwindung dieser Verfolgung. Und dies in einer Form wie jener Cohens, die Melancholie und Rebellion zusammenbringt und zusammendenkt. In der Sexualität und Religion, weltliche Genüsse und Spiritualität, aber auch Zen-Buddhismus und religiöses Judentum keine Widersprüche mehr sein müssen. In der die Gespenster eine Heimat gefunden haben.
Sein Roman »Schöne Verlierer« endet mit Zeilen, die schon 1966 diesen Anspruch zusammengefasst haben: »Arme Menschen, Menschen wie wir, sie sind verschwunden und entflohen. Ich will aus der Flugzeugkanzel für sie sprechen. Ich bin hindurchgegangen durch das Feuer von Familie und Liebe. Ein Willkommen dir, der du mich heute liest. Willkommen dir, Geliebter und Freund, der du mich ewig vermissen wirst auf deiner Reise dem Ende entgegen.«



 Nazis am Nil
Nazis am Nil