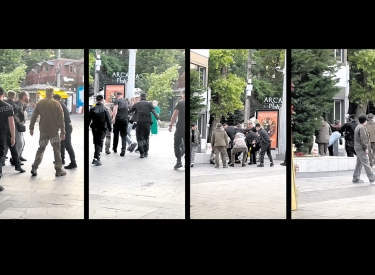Die Berechenbarkeit der Zukunft
Zehn Jahre nach seinem Tod und ein Vierteljahrhundert nach der ersten Veröffentlichung seiner damals äußerst provokanten These vom nahenden clash of civilizisations ist es merkwürdig still um Samuel P. Huntington geworden. Für Linke war der Politikprofessor aus Harvard einer, den man aus der Debatte über seine Bücher und Thesen zu kennen glaubte. Ein Rassist, der an den ewigen Kampf zwischen den Kulturen geglaubt habe, vor allem aber an die Überlegenheit des Westens und die inhärente Aggressivität des Islam sowie die Notwendigkeit, die aufstrebende chinesische Zivilisation einzudämmen. Unzählige sozial- und geisteswissenschaftliche Entgegnungen und Widerlegungen Huntingtons wurden im Laufe der Jahre verfasst. Der »Kampf der Kulturen«, wie seine bekannteste Arbeit in deutscher Übersetzung hieß, wurde zum geflügelten Wort, das Moderatorinnen im deutschen Fernsehen jederzeit anführten, wenn irgendwo ein Muslim eine US-amerikanische oder dänische Nationalfahne anzündete. »Droht nun der Kampf der Kulturen?« raunen dann die Moderatoren.
Viele – gerade linke – Kritiker Huntingtons haben es sich in der Vergangenheit leicht gemacht. Sie empfanden als Provokation, was gar nicht auf sie gemünzt war. Huntingtons These, dass die politischen Konflikte in »dieser neuen Welt« (gemeint war die Situation nach Ende der Blockkonfrontation) nicht ökonomische oder ideologische, sondern kulturelle Ursachen haben würden und als solche primär von der Religion bestimmt seien, musste auf Linke provozierend wirken. In einer vulgärmaterialistischen Sichtweise, der viele Linke bewusst oder unbewusst anhängen, geht es bei den meisten politischen Konflikten um den Zugang zu Ressourcen oder um andere materielle Interessen. Ideologie dient lediglich dazu, diesen Kämpfen irgendeine höhere Legitimation zu verleihen. Menschen ließen sich nun einmal besser dazu motivieren, für die Verteidigung der eigenen Lebensweise zu sterben als für billiges Öl oder die Kontrolle von Handelswegen. Kultur und Religion werden nach dieser Lesart nur ideologisch missbraucht. Somit wäre Huntingtons Aufsatz »A Clash of Civilzations?«, der 1993 in der Sommerausgabe der Zeitschrift Foreign Affairs erschien, schon auf der ersten Seite erledigt gewesen.
»Aber ist es nicht gerade der entscheidende Punkt, mit welchen Ideen sich die Menschen am besten gegeneinander aufbringen lassen, damit Konflikte überhaupt ausgetragen werden können?« hätte Huntington vielleicht im Hörsaal entgegnet. Im 19. Jahrhundert hätten die europäischen Großmächte und die USA als Nationalstaaten die Welt untereinander aufgeteilt, nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sich der Westen und die Sowjetunion als ideologisch verfeindete Systeme gegenübergestanden, während jede noch so kleine Guerillagruppe am Ende der Welt sich dem einen oder anderen Lager zugehörig erklärte – und nun, mit dem Ende des großen Systemkonflikts, seien eben Kultur und Religion starke Bindeglieder, um auf der Bühne der Weltpolitik Interessenskonflikte auszufechten. Entscheidend sei letztlich, welches die größtmögliche und stärkste politische Entität sei, mit der sich ein Mensch identifizieren könne. Was Huntington mit dem Kampf der Kulturen meinte, war eine Welt bestimmt von kultureller Identitätspolitik. Dass gerade besonders heftige politische Konflikte heutzutage häufig die Form von Kulturkämpfen annehmen, das lässt sich tatsächlich schwer bestreiten.
Ende der Geschichte vs. Untergang des Abendlands
Huntington wollte durchaus provozieren, aber nicht unbedingt Linke und nicht einmal Muslime. Seine Kritik galt vielmehr einer gewissen fröhlichen Unbekümmertheit bis hin zum selbstzufriedenen Triumphalismus, die Huntington beim politischen Establishments der USA und Europas wahrnahm. Die These vom »Ende der Geschichte«, die Francis Fukuyama, ein Schüler Huntingtons und wie er Professor in Harvard, ein paar Jahre zuvor – wenn auch weniger apodiktisch als das Schlagwort nahelegt – formuliert hatte, entsprach in gewisser Weise der herrschenden Stimmung. Der westliche Liberalismus habe sich durchgesetzt, die Zeit der ideologischen Konfrontationen und die aufopferungsvollen Kämpfe für große Ideen wie Freiheit seien Vergangenheit. Kriegerische Konflikte würden zwar auch in der Zukunft noch stattfinden, so Fukuyama, aber eher Indianerüberfällen ähneln, die das Weiterziehen des großen Trecks bestenfalls stören, aber nicht aufhalten könnten. Diese Art von Zuversicht ist angesichts der heutigen Weltlage tatsächlich kaum noch nachvollziehbar. Genau gegen diese Haltung wandte sich Huntington. Es war eine Mahnung: Nicht die Beine hochlegen, an den Rüstungsetats sparen oder fröhlich dem Rest der Welt liberale Demokratie und neoliberales Dogma verordnen.
Der Westen, warnte Huntington, sei zwar militärisch, technisch und ökonomisch auf dem Höhepunkt einer etwa 400jährigen Entwicklung – aber ab jetzt gehe es bergab. Die historisch gesehen relativ kurze Zeit weitgehender Kontrolle des Westens über den Rest der Welt neige sich dem Ende entgegen. Selbst die Blockkonfrontation sei letztlich das Produkt einer politischen Tradition, die im Westen ihren Ursprung hatte. Mit dem Ende der Blockkonfrontation träten nichtwestliche Akteure in den Vordergrund, ihre Ökonomien und ihre Bevölkerung seien im Wachstum begriffen. Eine Zeit der neuen Unordnung beginne.
Was Huntington mit dem Kampf der Kulturen meinte, war eine Welt bestimmt von kultureller Identitätspolitik.
Damals klang das übertrieben pessimistisch. Aus heutiger Sicht wirkt Huntingtons Prognose, der Westen könne seine militärische, technische und wirtschaftliche Vormachtstellung wahrscheinlich bis weit ins 21. Jahrhunderts behalten, fast schon optimistisch. Für den inneren Zusammenhalt der kulturellen Entität, die er als den Westen definierte – USA, Kanada sowie die meisten damaligen Nato- und EU-Staaten –, sah er wenige Schwierigkeiten. Er wies durchaus auf mögliche Probleme wie steigenden Rassismus als Reaktion auf Migration hingewiesen. Aber den EU-Austritt Großbritanniens, Donald Trump, die Krise der EU, interne Handelskriege – dass sich in so kurzer Zeit innerhalb des Westens derartig selbstzerstörerische Kräfte entwickeln würden, die den prognostizierten Niedergang eher beschleunigen, darauf deutet in Huntingtons Buch »The Clash of Civilzations« kaum etwas hin.
In der neuen multipolaren Weltordnung würden, so hatte Huntington argumentiert, nicht wie im 20. Jahrhundert große ideologische Blöcke einander begegnen, sondern Zivilisationen – begründet durch kulturelle Faktoren wie Sprachfamilien, gemeinsame Geschichte, vor allem aber Religion. Huntington machte insgesamt sieben bis acht solcher Zivilisationen aus – die westliche, die chinesische, die islamische, die orthodoxe, die hindusitische, die lateinamerikanische, die buddhistische und möglicherweise die afrikanische. Ob Afrika sich als eigenständige Zivilisation qualifiziere, da war sich Huntington selbst unsicher. In seiner Darstellung überzeichnete er das Bild von diesen Zivilisationen stellenweise derart, dass man den Eindruck bekommen konnte, als handle es sich dabei um essentiell unveränderliche Blöcke, die eine Art kulturelles Gedächtnis von Konflikten oder Feindbestimmungen in sich tragen.