Das komplizierte Glück
Manchmal überkommt einen die traurige Erkenntnis, wie eingefahren das eigene Literaturverständnis ist. Das merkt man deutlichsten, wenn man mit einem Text konfrontiert wird, der sich diesem oder jenem erlernten Zugriff entzieht. Wenn auf einmal die Einordnung zwischen den beiden Polen der gegenwärtigen Literaturdebatte – irgendwie autonomieästhetisch begründete Feier der »reinen Fiktion« am einen, autofiktionales Schreiben, legitimiert durch erlebte Erfahrung am anderen Ende – nicht mehr funktionieren will, wächst so langsam die Erkenntnis, wie wenig sich mit diesen Begriffen überhaupt über Literatur sagen lässt.
Ein solcher Text ist der 2017 erschienene und im vergangenen Jahr ins Deutsche übersetzte Roman »Zensus« des US-amerikanischen Autors Jesse Ball. Das Buch beginnt mit einem Vorwort, welches es sofort mit der Aura des biographisch Verbrieften versieht: »Mein Bruder Abram Bell starb 1998. Er war vierundzwanzig Jahre alt und hatte das Down-Syndrom. Zum Zeitpunkt seines Todes war er schon jahrelang an ein Beatmungsgerät angeschlossen, war seit Jahren querschnittgelähmt, war Dutzende Male operiert worden. Sein Unglück war kompliziert, aber sein großartiges, wundervolles Naturell veränderte sich nicht.«
Nach einer solchen Einleitung ist die Erwartung an einen Roman nicht unbedingt die, im ersten Kapitel einem namenlosen Mann beim Ausheben seines eigenen Grabs beizuwohnen. So kommt es aber, und dass es sich bei dem Erzähler auch noch um einen Volkszähler handelt, der kreuz und quer durch ein ebenso namenloses Land fährt, dessen Städte nach den Buchstaben des Alphabets geordnet sind, der die Bewohnerinnen dieser mysteriös bleibenden Nation nach der Zählung auf die Rippen tätowiert und nie so richtig weiß, warum er das eigentlich tut, lässt die Kluft zwischen der Erwartung, die durch die klare Markierung des Stoffs als biographische Geschichte aus dem Leben von Jesse Ball entsteht, und der fast schon an Science-Fiction denken lassenden Form, die Ball eben diesem Stoff gibt, umso größer werden. Und das ist gut so.
»Zensus« ist Balls siebter Roman und alle davor veröffentlichten ließen sich, wenn überhaupt, als modernistische Fabeln beschreiben, mit absurden Elementen gespickt und in stets dämmrigen Welten angesiedelt.
»Zensus« ist Balls siebter Roman und alle davor veröffentlichten (angefangen mit »Samedi the Deafness« von 2007) ließen sich, wenn überhaupt, als modernistische Fabeln beschreiben, mit absurden Elementen gespickt und in stets dämmrigen Welten angesiedelt, die der unseren bestenfalls ähneln. Da ist es klar, dass ein Buch dieses Autors, selbst eines, das sich explizit mit Biographischem auseinandersetzt, nicht nach den gängigen Regeln der Autofiktion funktionieren wird.
Der verstorbene Bruder Balls, über den er eigentlich schreiben möchte, während sich die Erinnerung an ihn zugleich anfühlt »wie ein niedergetrampelter Garten«, ist in »Zensus« auf eine eigenartige Weise anwesend und abwesend: Er tritt hier als Sohn des Volkszählers auf, der ihn auf seiner Reise begleitet. Er ist auf den ersten Blick Nebenfigur und doch heimliches Zentrum des Romans. Dass diese Reise zugleich die letzte des Vaters sein wird – der Witwer und ehemalige Chirurg ist tödlich krank –, rückt die Erzählung über eine Verschiebung wieder nahe an den ursprünglichen Antrieb des Schreibens: die Trauer. Aus dem trauernden Bruder wird so ein trauernder Vater, der nicht um sich selbst trauert, sondern um die Zukunft, die er mit seinem Sohn nicht haben wird.
Es sind diese Kniffe, wegen derer »Zensus« so stark ist. Die Handlung dagegen folgt den Regeln eines Road Trips und ist dementsprechend fragmentiert bis kaum vorhanden: Von A bis Z durchfahren Vater und Sohn verschiedene Ortschaften und treffen dort auf das Volk, das sich mal mehr, mal weniger freiwillig zählen lässt. Auf der Reise driftet der Vater immer wieder in Reflexionen über seine Tätigkeit, sein Verhältnis zu seinem Sohn, seine Rolle als Vater, als Ehemann, als Beobachter und Teilnehmer. Die Erzählhaltung wirkt in diesen Passagen abstrakt und kalt: »Ein Volkszähler muss – mehr als alles andere – nach Leere streben, sich sogar nach ihr sehnen.« Einige Zeilen später heißt es, der titelgebende Zensus bedeute, »mit einer Laterne in das Unwetter« zu gehen, und ein Volkszähler habe deshalb immer »etwas Hilfloses«.
Nicht nur in diesen so apodiktischen wie unscharfen Bestimmungen, von denen die eine über die andere zu stolpern scheint, nähert sich Ball den Texten eines gewissen Autors aus Prag an – auch das Personal, die Behörden mit uneindeutigem Aufgabengebiet, die namenlosen Städte mit ihren beziehungslosen Bewohnern scheinen direkt aus einer Erzählung von Franz Kafka zu stammen. Das macht Ball aber nicht zu einem bloßen Epigonen oder Nachahmer.
Von Kafka übernimmt »Zensus« auch die Ästhetik des Abbruchs, in der jeder Sinn, der sich vorsichtig entwickelt, sofort wieder einkassiert wird – und Bedeutung wohl am ehesten in ihrem Ausbleiben zu suchen ist. Aussagen über den eigentlichen Sinn der Volkszählung sowie über die Rolle der Volkszähler widersprechen sich in einem fort und führen Leserinnen damit in einen Zustand, in dem die Welt kenntlich wird, aber doch nicht so ganz.
Ball nun übernimmt Elemente dieses Schreibens und nutzt sie, um zärtliche Nähe und zugleich auch die unüberbrückbare Fremdheit zu evozieren, die im Verhältnis zwischen ihm und seinem verstorbenen Bruder, wie auch spiegelbildlich in der Beziehung zwischen sterbendem Vater und geliebtem Sohn, aufscheint. »Aber es ist nicht einfach, ein Buch über jemanden zu schreiben, den man kennt«, steht im Vorwort zu »Zensus« – und parallel dazu erscheint dem Vater seine Umgebung als »trüb und wird immer trüber, auch wenn manchmal etwas Klares durchkommt, etwas Klares, das den Rahmen sprengt«.
Dieses »Klare« sind in »Zensus« die Schilderungen des Sohns, die zugleich daran erinnern, dass bei der Beschreibung eines Menschen stets etwas unverfügbar bleibt. Beispielhaft eindrücklich in der Szene, in der der Erzähler seinem Sohn vom Tod der Mutter berichtet: »Ich sagte es mehrmals, auf unterschiedliche Arten. Als ich es ihm sagte, sagte ich es auch mir zum ersten Mal. Was er darüber weiß – darüber, dass sie tot ist, ist nicht das, was ich weiß, denn das, was er darüber wusste, dass sie am Leben war, war etwas anderes als das, was ich wusste.«
Ball gelingt es, die Welt so undurchdringlich und gleichzeitig alltäglich zu zeigen, wie sie einem erscheinen muss, für den sie nicht gebaut worden ist und der doch jeden Tag aufs Neue lernen muss, in ihr zu leben.
In diesen Szenen ist »Zensus« auch ein Buch über Behinderung, ohne dass es an irgendeiner Stelle zu verstehen gäbe, sein Autor habe davon signifikant mehr verstanden als andere Menschen. »Zensus« ist nicht belehrend, nicht offensiv politisch, sondern in seiner skurrilen, kalten Welt sehr persönlich und zärtlich, ohne zu verklären. Das Unverständnis des Sohns gegenüber der strengen Welt der Erwachsenen wird nicht heiliggesprochen und behält doch etwas Rührendes. Es rührt an, weil es das klare Zentrum einer ansonsten nebligen Szenerie bildet, worin all das, was das Leben in dieser Gesellschaft grausam, aber auch, was es schön macht, besonders deutlich wird.
In diesem Wechselspiel gelingt es Ball, die Welt so undurchdringlich und gleichzeitig alltäglich zu zeigen, wie sie einem erscheinen muss, für den sie nicht gebaut worden ist und der doch jeden Tag aufs Neue lernen muss, in ihr zu leben. So gehen autobiographischer Stoff und fabulierendes Schreiben ineinander über und lassen etwas Neues entstehen, das jenseits der abgesteckten Kategorien des Literaturbetriebs liegt. Dem österreichischen Luftschacht-Verlag, der vor Ball schon andere Randläufer der englischsprachigen Literatur wie Dennis Cooper oder Oisín Curran auf Deutsch verlegte, ist dafür zu danken.
Und für all diejenigen, die sich von solchen theoretischen Überlegungen nicht überzeugen lassen, sei noch hinzugefügt, dass das Ende des Buchs zum Traurigsten und Schönsten gehört, was in den letzten zehn Jahren veröffentlicht worden ist. »Sein Unglück war kompliziert«, heißt es in Balls Einleitung zu »Zensus« – und dieser Satz ist in seiner Holprigkeit sehr wahr. Wahr ist aber auch, dass »Zensus« von einem ebenso komplizierten Glück handelt: der Liebe zu denen, die der Fürsorge bedürfen. Und wer das Buch zu Ende gelesen hat, versteht vielleicht, dass es zur Beschreibung dieses Gefühls manchmal einer solchen pathetischen Formulierung bedarf.
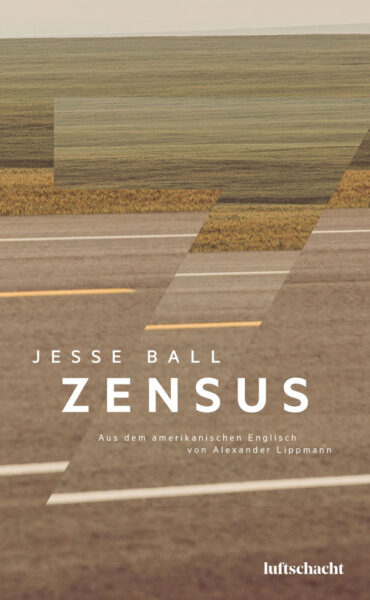
Jesse Ball: Zensus. Aus dem amerikanischen Englisch von Alexander Lippmann. Luftschacht-Verlag, Wien 2022, 283 Seiten, 24 Euro






 Fortschritt in the Slaughterhouse
Fortschritt in the Slaughterhouse