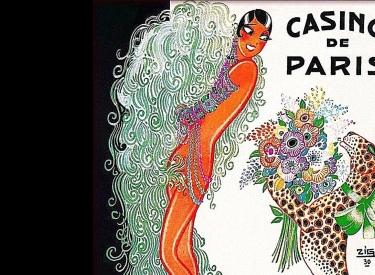Volksherrschaft versus Rechtsstaat
Der frei gewählte philippinische Präsident brüstet sich öffentlich mit Mordtaten. Die Regierungen Ungarns und Polens gehen gegen unabhängige Justiz und kritische Medien vor. Was das für die Meinungsfreiheit, für Juden und Israel heißt, demonstriert Polen mit dem Verbot, über »eigene« Mittäter am Holocaust zu reden. Die AfD will einen Journalisten, der ihr nicht passt, durch das Parlament verdammt sehen – gängige Praxis in Diktaturen.
Kaum ist die FPÖ an der Macht, lässt ihr Innenminister Material des Verfassungsschutzes beschlagnahmen, das vermutlich Verbindungen seiner Partei zu offen faschistischen Kräften dokumentiert. In Dänemark soll nach dem Willen der Regierung künftig unterschiedliches Strafmaß für das gleiche Vergehen gelten, je nachdem, in welchem Viertel die Delinquenten leben. Die »oppositionellen« Sozialdemokraten zeigen sich gesprächsbereit und befeuern ihre Hoffnung auf baldige Regierungsübernahme mit dem Vorschlag, das Asylrecht sogar offiziell abzuschaffen. Rechtspopulismus heißt Angriff auf den Rechtsstaat. Mit Massenunterstützung. Ein Viertel der Österreicher wünscht sich bereits »einen starken Führer, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern muss«.
Die explosive Stimmung, das diese Gesellschaft in den Abgrund zu reißen droht, wurde im Miniaturformat in der Debatte um die Essener Tafel sichtbar.
Hierzulande ist es nicht wesentlich besser. Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Statt von Rechtspopulismus sollte man von Protofaschismus reden.
Yascha Mounk hat recht. Die liberale Demokratie des Westens ist ernsthaft in ihrer Existenz bedroht. Sein Appell, sich der Gefahr entgegenzustellen, ist sympathisch. Seine Rezepte allerdings, nämlich »mehr dafür tun, dass Leute durch ihr Einkommen wohlhabend werden können« und »den Nationalismus domestizieren«, sind illusionär. Im Prinzip ist das die Antwort aller gutwilligen Liberalen, die glauben, man könne die aus den Fugen geratene bürgerliche Gesellschaft mit ihren eigenen Mitteln schon wieder irgendwie stabilisieren. Mounks Eingeständnis, er habe (übrigens wie fast alle anderen auch) »vor ein paar Jahren noch« geglaubt, dass »die liberale Demokratie in Ländern wie Deutschland, den USA oder Schweden für immer gesichert sei«, verweist auf die verbreitete Ahnungslosigkeit vom Geburtsfehler dieser Gesellschaft – von ihrem selbstzerstörerischen Krisenpotential nämlich.
Die Konkurrenzsubjekte der vereinzelten Warenverkäufer, die untereinander bis aufs Messer um die Gunst des Marktes kämpfen müssen, sind auf »jeder gegen jeden« getrimmt. Der Ausbruch der offenen Barbarei, die darin angelegt ist, wurde mal weniger, mal mehr, mal gar nicht verhindert. Sei es durch ein Minimum an Zivilisiertheit und Anstand, sei es durch das Fehlen derselben. Die Angst vor dem Sturz ins Bodenlose ist der bedrohliche Schatten, der die Insassen der bürgerlichen Gesellschaft ihr Leben lang begleitet. In Zeiten gefüllter Sozialkassen, ermöglicht durch eine aufstrebende Ökonomie, die fast alle Gesellschaftsmitglieder inkludierte, war dieser Schatten zeitweilig etwas verblasst. Im letzten Jahrzehnt aber wurde zum Allgemeinwissen, dass der Laden nicht mehr rund läuft. Die gigantische Steigerung der Arbeitsproduktivität führt nicht zu einem besseren Leben für alle, sondern macht systemlogisch immer mehr Menschen »überflüssig«. Der unerbittliche Primat der Ökonomie verbaut die Rückkehr zum Sozialstaat vergangener Tage.
Selbst in Deutschland, dessen starke Weltmarktposition das Problem bis jetzt noch deutlich kleiner hält als vielerorts, beschleicht immer mehr Leute eine Ahnung vom bevorstehenden Untergang der einstmals so sicher geglaubten Welt. Die Konkurrenzsubjekte geraten in Panik. »Werde ich als nächstes zu den Wertlosen gehören? Wer will sich da an unseren Sozialsystemen mästen?« Wären die Panischen Argumenten zugänglich, würden sie einsehen, dass die Existenz von »Wirtschaftsflüchtlingen«, über die sie sich so erregen, eine einzige Anklage gegen ein Wirtschaftssystem ist, das hunderten Millionen Menschen nichts als Perspektivlosigkeit bietet. Doch sie suchen Schutz und Identität im nationalen Kollektiv und kennen nur noch: »Wir oder die?« Die Angst der Konkurrenzsubjekte vor dem Abstieg wird zum Quell ihrer Aggressivität.
Die explosive Stimmung, die diese Gesellschaft in den Abgrund zu reißen droht, wurde im Miniaturformat in der Debatte um die Essener Tafel sichtbar, die Nichtdeutschen den Zutritt verweigerte. Drei brandgefährliche Entwicklungen vermengen sich miteinander.
Erstens spuckt das Kapital immer mehr Arme und Entwürdigte aus. Zweitens tun Staat und Politik kaum etwas dagegen. Drittens begehren die Betroffenen nicht etwa gegen die Zustände auf, sondern treten mit Füßen gegen die, die nicht »zu uns« gehören. Der teils noch uneingestandene, zusehends aber schamlos offen artikulierte Hass gegen »die anderen« ist stärker als der Wunsch, die Ursachen von Armut und Entwürdigung zu beseitigen. Zwei Drittel der Deutschen bekundeten »Verständnis« für die nationalistische Entscheidung der Essener Tafel und auch in den politischen und intellektuellen Eliten häufen sich seitdem die menschenfeindlichen Töne. Anders als Yascha Mounk meint, lässt sich das Ressentiment eben nicht domestizieren. Was gestern noch »Patriotismus« war, heißt heute schon Vorrecht der »angestammt Berechtigten« (Alexander Dobrindt) und entpuppt sich morgen als glühender Fremdenhass.
Zum Glück bringt die bürgerliche Gesellschaft auch anderes hervor. Ihr »frei und gleich« steht eben nicht nur für den Krieg aller gegen alle. Noch jede Emanzipationsbewegung hat sich darauf berufen und bewies damit, dass darin auch der Anspruch angelegt ist, kein Mensch möge über einem anderen stehen oder Angst davor haben, verschieden zu sein. Forderungen, die letztendlich über diese Gesellschaft selbst hinausweisen. »Rechtspopulisten«, Halb- und Ganzfaschisten wissen jedenfalls genau, warum sie gegen diesen Anspruch Sturm laufen. Die alte BRD erlebte zumindest zwei Zivilisierungsschübe, deren Ausbleiben in der DDR sich heute besonders schmerzlich bemerkbar macht: Reeducation und Achtundsechziger-Bewegung – nicht zufällig Feindbild von AfD, Pegida & Co. Und wenn jede Menge Tafeln keinen rassistischen Ausschluss betreiben, so verweist auch das auf ein nach wie vor großes Potential gegen die faschistische Gefahr.
Doch diejenigen, die an menschlicher Emanzipation festhalten, bieten derzeit kein ermutigendes Bild. Die einen ignorieren die Diktatur der Ökonomie und verlieren sich und ihr Ziel im realpolitischem Gestrüpp. Andere ergehen sich in hohlem Revolutionsgeschwätz. Nicht wenige zeigen sich anfällig für allerlei Querfrontlerisches. Manchem verbaut ein obsessiver Tunnelblick auf den Islam die Sicht auf den anschwellenden Faschismus, der aus der Mehrheitsgesellschaft erwächst. Gut meinende Antifaschisten wiederum verwechseln Kritik an religiösem Fanatismus und Mackertum mit Rassismus. Antisemitismus und regressiven Antikapitalismus haben die wenigsten verstanden. Wer dagegen eine einigermaßen treffende Analyse hat, zuckt in Sachen realisierbare Alternativen hilflos die Schultern und kommt bestenfalls über den Verweis auf rudimentäre Abwehrkämpfe nicht hinaus.
Die wichtigste praktische Interventionsmöglichkeit bleibt die Verbreitung von Kritik. Denn ob sich das emanzipatorische oder das faschistische Potential durchsetzt, hängt wesentlich davon ab, dass diejenigen, die eine humane Welt wollen, ihr großes Defizit überwinden: Sie müssen lernen, über den Horizont der warenproduzierenden Gesellschaft hinauszuschauen. Ohne Verständnis für die Ursachen der Krise kommt man nicht aus ihr heraus. Für die Kritikerinnen empfiehlt sich im Gegenzug weniger Arroganz gegenüber Leuten, die nach praktischen Auswegen suchen. Lohnender wäre allemal gegenseitiges Interesse. Der Ausgang ist offen.







 Straight Out of Gotham City
Straight Out of Gotham City