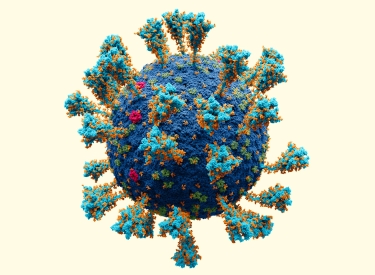»Keine Regierung kann die Verbreitung von Fotos stoppen«
Polizeigewalt, Einschüchterung, Zensur – die Situation für Journalistinnen und Journalisten in Griechenland verschlechtert sich. Eine starke Interessenvertretung wäre gefragt. Was läuft falsch?
Als Fotoreporter und auch bei der beruflichen Interessenvertretung haben wir leider nicht begriffen, welche Macht in unseren Händen liegt. Ich meine die Fotografie, und ich betone »leider«. Gehen wir mehrere Jahrzehnte zurück. Damals konnte man die Fotoreporter an einer Hand abzählen und in den Zeitungen waren dennoch mehr Fotos als Text. Doch die damaligen Kollegen haben für die künftigen Generationen von Fotoreportern überhaupt nicht vorgesorgt.
»Die Polizei folgt den Befehlen der Regierung. Das Vorgehen der Polizisten ist noch aggressiver und unvorhersehbarer geworden. Aber der Versuch, die Presse auch mit Polizeigewalt gegen Journalisten mundtot zu machen, ist zum Scheitern verurteilt. Fotoreporter und Journalisten werden nicht nachgeben und weiterhin über alles berichten.«
Woran liegt das?
Ich will ehrlich sein, die Schuld liegt allein bei uns. Wir haben unsere Kontakte, die Bekanntschaft mit Ministern und Ministerpräsidenten, nicht genutzt. Wir haben keine starke Sozialversicherung aufgebaut und uns auch nicht in einer Fotoagentur vereinigt. So hätten wir unsere Ausgaben begrenzen können, nur zwei statt 15 Kollegen müssten in ein Fußballstadion oder zu Veranstaltungen gehen. Wir hätten keinen selbstzerstörerischen, unlauteren Wettbewerb untereinander, sondern stattdessen eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber den Verlegern.
Polizeigewalt gegen Journalisten ist kein ausschließlich griechisches Problem. Wenn Polizisten nicht wollen, dass Bilder ihres Vorgehens beispielsweise gegen den Demonstrierende veröffentlicht werden, versuchen sie, Journalisten einzuschüchtern, und schrecken auch vor Gewalt und Festnahmen nicht zurück. Allerdings kommen die Befehle dafür von oben. Dabei erliegen die, die sie geben, aber einer Fehleinschätzung, denn so kann ein professioneller Fotoreporter oder Journalist nicht gebrochen werden. Im Gegenteil, er wird nur beim nächsten Mal vorsichtiger sein – und effektiver arbeiten. »Das erste Opfer ist die Wahrheit«, sagt man über den Krieg. Ähnliches gilt für Revolutionen, Unruhen und Demonstrationen. Die Wahrheit ist den Herrschenden unbequem. Aber es ist unsere Aufgabe, sie zu zeigen.
Polizisten haben Ende Februar bei einer Demonstration für die Anliegen des Hungerstreikenden Dimitris Koufontinas (Jungle World 10/2021) sieben Journalisten verletzt, die NGO Reporter ohne Grenzen fordert eine Untersuchung. Was ist da los?
Die Polizei folgt den Befehlen der Regierung. Das Vorgehen der Polizisten ist noch aggressiver und unvorhersehbarer geworden. Aber der Versuch, die Presse auch mit Polizeigewalt gegen Journalisten mundtot zu machen, ist zum Scheitern verurteilt. Fotoreporter und Journalisten werden nicht nachgeben und weiterhin über alles berichten.
Auch in Frankreich sollten die Möglichkeiten, Polizeieinsätze zu dokumentieren, erheblich eingeschränkt werden. Es ist hinreichend bekannt, dass Polizisten dort die Gesetze gebrochen haben, zum Beispiel bei der Gewaltanwendung gegen Proteste der »Gelbwesten«. In den USA wäre der Mord an George Floyd, dem ein Polizist in Minneapolis fast neun Minuten lang den Hals mit seinem Knie zudrückte, nie bekannt geworden, wenn es keine Fotos und kein Video gegeben hätte. Die Barbarei und der Rassismus, beides leider immer noch existent an vielen Orten der Welt, wären vertuscht worden.
Hier in Griechenland, in der »Wiege der Demokratie«, wollte die Regierung uns bei Protesten Orte zuweisen, von denen aus wir nur mit polizeilicher Erlaubnis hätten fotografieren dürfen. Das ist etwas weltweit Einmaliges, was es nicht einmal in der »Dritten Welt« gibt – ich habe es in meiner langen Karriere nirgendwo erlebt. Gut, diese Regelung wurde zurückgenommen, weil es erheblichen Druck gab, aber das Vorhaben hat deutlich gezeigt, wie die Regierung zur Pressefreiheit steht.
In sozialen Medien werden Seiten von Journalisten gesperrt, wenn sie Fotoreportagen über Demonstrationen für Koufontinas veröffentlichen. Hätten Sie sich vorstellen können, dass wir so etwas erleben?
Wenn ich vor Jahren gefragt worden wäre, hätte ich voller Überzeugung »nein« gesagt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber heute sage ich ebenso überzeugt »ja«. Mit Verlaub, ich glaube, wir leben im Dschungel des Internets. Unsere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ERT wird mit Geldern der Bürger finanziert. Als ich sah, dass an Türen, Aushängen und auch im Aufzug des Hauptgebäudes der ERT Ankündigungen aufgehängt wurden mit der Anordnung, dass von der ERT keinerlei Berichte über die Demonstrationen für Koufontinas ausgestrahlt werden sollen, war für mich klar, dass Ähnliches auch im Internet geschehen wird. Wer merkt denn nicht, dass ein großer Teil unserer Zeitungen, Internetmagazine, Fernseh- und Radiosender nicht frei berichtet?
Ein weiterer Grund ist, dass Pavlos Bakoyannis (der konservative Politiker wurde 1989 von der »Revolutionären Organisation 17. November« erschossen, der Koufontinas angehörte, Anm. . Red.) sehr eng mit Kyriakos Mitsotakis verbunden war, der nun Ministerpräsident ist. Bakoyannis war sein Schwager. Allein das reicht aus, um die Sperrung der Seiten der Kollegen zu verstehen.
»Als Reporter von Associated Press habe ich eine etwas bessere Behandlung durch die Junta erlebt als andere. (...) Aber nicht alle Kollegen hatten dieses Glück. Einen Journalisten versteckte ich in meiner Dunkelkammer in Athen. Einem anderen half ich bei der Flucht über das Ziegeldach des Nachbargebäudes. Ich glaube, diese Beispiele reichen, um die Unterschiede zu den Verhältnissen der heutigen Zeit zu erkennen.«
Wie schätzen Sie die derzeitige Gefahr für Fotoreporter in Griechenland ein?
Das ist eine gute Frage. Fotoreporter waren immer in Gefahr und sind es weiterhin, wenn sie ihren Beruf ausüben. Man muss nicht »Kriegsreporter« sein, wie die Kollegen, die über bewaffnete Konflikte berichten, genannt werden. Es reicht eine Leuchtrakete eines Fußballfans in einem Stadion, um einen Fotoreporter ins Krankenhaus zu bringen. Immer wieder ist es der Schlagstock eines Polizisten, der den Kopf eines Fotoreporters trifft und diesen mehr oder weniger schwer verletzt.
All dies ist für jeden Fotoreporter ein Berufsrisiko. Mit meinen 40 Jahren Berufserfahrung habe ich das Recht zu sagen: »Wenn du nichts riskierst, hast du kein Foto.« Aber ich habe auch immer im Sinn: »Dein Leben ist so viel wert, wie eine Kugel kostet.« Die Schlussfolgerung liegt bei Ihnen.
1973 hätte eine Kugel Sie das Leben kosten können. In der Nacht des 17. November waren Sie als einziger Berichterstatter beim Polytechnikum in Athen. Wie kam es dazu?
Drei Tage lang war das Zentrum Athens bereits ein Schlachtfeld. Wie meine Kollegen auch musste ich einen einsamen Kampf führen, um die schockierenden Ereignisse unter Lebensgefahr aufzuzeichnen. Die Polizei feuerte tagsüber mit Plastikkugeln, aber in der Abenddämmerung feuerten bewaffnete Männer auf Dächern und Balkonen rund um das Polytechnikum mit scharfer Munition.
Tagsüber am 17. November 1973 waren die Zusammenstöße viel heftiger als sonst, die Polizei schlug jeden zusammen, der ihnen über den Weg lief. Der Radiosender »Freie Kämpfende Studenten« schickte seine Botschaft über »Brot, Ausbildung und Freiheit« ins ganze Land. Ich schickte gerade die Fotos, die ich am Tag gemacht hatte, ins Ausland, als ich gegen 21 Uhr die Panzerketten auf dem Asphalt hörte. Ich informierte meinen Chef, Phil Dopoulos. Wir fuhren in einem Jaguar mit englischen Nummernschildern. Durch zwei unglaubliche Zufälle vermochten wir den Panzern zu folgen, die ins Zentrum zum Polytechnikum fuhren – und das in einem Athen, in dem Zivilisten sich nicht mehr frei bewegen konnten.
Mit einer gehörigen Portion Frechheit hatte ich mich fast genau gegenüber dem Eingangstor des Polytechnikums aufgebaut. Um mich herum waren mehrere Dutzend Polizisten und zahlreiche bekannte Provokateure. Ich zog meine Kameras aus der Tasche und fotografierte ohne Unterbrechung, ohne dass der Sergeant auf dem Panzer sich rührte. Dieser hielt mit einer Hand den Revolver und mit der anderen das Telefon, mit dem er mit seinen Vorgesetzten kommunizierte. Ich fotografierte selbstverständlich ohne Blitz.
Wie ging es dann weiter?
Gegen 2.55 hr walzte der Panzer das zentrale Portal des Polytechnikums nieder. Die Eisengittertür wurde heruntergedrückt, das öffnete den Weg für die Polizisten und Soldaten, die das besetzte Polytechnikum stürmten. Es folgten Hunderte Schüsse, Schreie und alles, was sich ein Mensch denken kann. Während der gesamten Zeit, in der ich dort war, gab es ein Bild, das ich gern gemacht hätte. Ich musste mich schnell entscheiden und entschied, es nicht zu machen. Denn ich wollte bis zum Ende bleiben. Hätte ich für ein Close-up meine Position verlassen, so wäre ich mit Sicherheit festgenommen und zum Gebäude der Sicherheitspolizei direkt hinter dem Polytechnikum gebracht worden.
Als am nächsten Mittag die ausländischen Zeitungen mit meinen Fotos auf der Titelseite in Athen ankamen, musste Stylianos Pattakos, der Innenminister der Diktatur, seine bisherigen Angaben korrigieren und zugeben, dass das Polytechnikum gestürmt worden war und so »diese Geschichte mit den Scheißkindern ein Ende fand«, wie er sagte.
Würden Sie sich heutzutage anders verhalten?
Ob Sie es glauben oder nicht, ich verfolge immer noch alle Ereignisse. Ich schlafe mit einem Radio auf dem Nachttisch und schlummere mit den letzten Nachrichten ein. Dann wache ich mit Nachrichten am Morgen auf. Das ist meine Gewohnheit seit Jahrzehnten, nichts hat sich daran geändert. Wenn etwas Wichtiges geschieht, suche ich meine Fotoapparate und eine innere Stimme sagt mir: »Hey, was mache ich hier?«
Auch mit 83 Jahren fühle ich mich bereit, zum Ort des Geschehens zu eilen und als Chronist die Ereignisse abzulichten. »Einmal Fotoreporter, immer Fotoreporter«, kommentierte vor wenigen Tagen die Kollegin Tatiana Bolari auf Facebook meine aktuellen Fotos.
Im digitalen Zeitalter ist es einfacher geworden, zu filmen, zu fotografieren und die Bilder oder Videos zu verbreiten. Es ist nicht mehr damit getan, einen Fotoapparat oder ein Negativ zu beschlagnahmen. Kann eine Regierung heutzutage die Verbreitung von Bildern überhaupt noch verhindern?
Wenn wir über die Schwierigkeiten meiner Zeit reden, dann war es nicht nur der Film. Denn alles musste per Hand gemacht werden. Es war schwierig für mich, in Mittelasien zu reisen, in Afrika und über den Balkan. Denn ich musste immer Material für eine Dunkelkammer mitschleppen, Papier, Entwickler, Becken, Trockner, Druckmaschine und einen Transmitter, um die Fotos zu senden. Die dicken schwarzen Tücher, um die Badezimmerfenster in einem Hotel abzuhängen, meine Kleidung, meine Kameras – sechs bis sieben Koffer waren die Regel. Andererseits war es eine andere Epoche. Man fühlte das Foto vom Moment des Drückens auf den Auslöser bis zum Moment, in dem es mit dem Transmitter in die Welt geschickt wurde. Das Foto war haptisch greifbar. Ich spielte mit Schatten und Abtönungen. Ich wurde eins mit dem Foto. Daher sind wir alten Hasen verliebt in die Fotografie.
Und nein, keine Regierung kann die Verbreitung von Fotos verhindern. Wenn sie es versucht, weckt dies Interesse an den Fotos, die dann erst recht verbreitet werden. Denn Fotos sind ein Spiegel der Wahrheit. Zudem wissen die Regierenden, dass sie nur über Fotos bekannt und berühmt werden.
Viele, vor allem jüngere Griechinnen und Griechen reden von einer »Junta«, einer Diktatur, wenn es um die derzeitige konservative Regierung geht. Sie haben die griechische Militärdiktatur, von 1967 bis 1974 regierte, als professioneller Reporter erlebt und Kriegsgebiete besucht. Halten Sie den Begriff »Junta« für angemessen?
Ich habe im Leben erfahren, dass die schlimmste demokratische Regierung immer noch besser ist als jede Junta. Wir sollten den Begriff nicht verwenden, denn er ist mit schlimmen Erinnerungen von Millionen von Menschen verbunden, welche die Junta erlebt haben. Die derzeitige Regierung hat, wie andere seit der Metapolitevsi (Regierungswechsel, die Zeit nach dem Fall der Diktatur am 24. uli 1974, Anm. d. ed.), viele Fehler gemacht. Wir sollten sie nicht mit der Junta gleichsetzen. Wir erleben schlimme und schwere Zeiten, machen wir sie nicht noch schlimmer.
Persönlich habe ich als Reporter von Associated Press eine etwas bessere Behandlung durch die Junta erlebt als andere. Obwohl ich mehrfach festgenommen und oft in das Folterzentrum in der Bouboulinas-Straße (damaliges Hauptquartier der Sicherheitspolizei in Athen, Anm. d. Red.) gebracht wurde, kam ich immer schnell wieder frei. Aber nicht alle Kollegen hatten dieses Glück. Einen Journalisten versteckte ich in meiner Dunkelkammer in Athen. Einem anderen half ich bei der Flucht über das Ziegeldach des Nachbargebäudes. Ich glaube, diese Beispiele reichen, um die Unterschiede zu den Verhältnissen der heutigen Zeit zu erkennen.
Was beschäftigt Sie derzeit?
Die Pandemie. Wir leben weltweit in einer sehr schwierigen Situation. Ich erlebe die Pandemie ebenso wie die übrigen Griechen. Mit Vorsicht, Duldsamkeit und Ausdauer hoffen wir alle, diese Situation schnell überwinden zu können. Persönlich belastet mich am meisten, dass Covid-19 auch die jungen Menschen und die Kinder trifft. Die Krankheit macht keine Ausnahmen, es macht mich sehr traurig.

Aristotelis Sarrikostas lieferte der Weltöffentlichkeit im November 1973 unter Einsatz seines Lebens Bilder von der Erstürmung des Athener Polytechnikums durch die Soldaten der Militärjunta. Er ist einer der wenigen griechischen Fotoreporter, die Erfahrungen mit Auslandseinsätzen in Kriegsgebieten haben. 1937 geboren und immer noch beruflich tätig, wandte er sich Anfang Januar mit einem Appell an die Union of Greek Photoreporters, seinen Berufsverband. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte durchzusetzen versucht, dass Journalisten über Proteste nur von ihnen zugewiesenen Plätzen aus und in Kooperation mit einem Polizeioffizier berichten dürfen. In seinem Appell schreibt er: »In meinen 40 Jahren als Fotojournalist/Auslandskorrespondent für die Associated Press bin ich um die Welt gereist und habe über Kriege und die wichtigsten Ereignisse berichtet. Die Medien bitten nicht um Erlaubnis, um über die Ereignisse zu berichten, sonst gäbe es keine schockierenden Fotos als Zeugnisse. Fotojournalisten und Journalisten müssen das reale Geschehen vor Ort dokumentieren, sie können nicht von Kommunikationsoffizieren der Polizei gefilterte Informationen verbreiten.«


 Die Akte Koufontinas
Die Akte Koufontinas