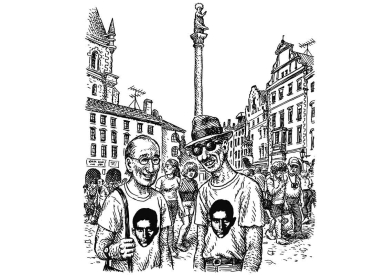Shklars Karte
Als Judith Shklar ihren Aufsatz über den Liberalismus der Furcht veröffentlichte, versuchte sie, ihn zwischen zwei bekannteren Spielarten zu verorten: dem Bildungs- oder Selbstvervollkommnungsliberalismus auf der einen und dem Liberalismus der Rechte auf der anderen Seite. Das war mit groben Strichen gezeichnet, aber die sich daraus ergebende Landkarte des politischen Denkens war nicht falsch. Wobei die Frage ist, wie eine akkurate eigentlich aussehen müsste.
Sicherlich lässt sich die Geschichte des Liberalismus leicht als eine Abfolge blinder Flecken – oder, noch deutlicher gesagt: diverser Heucheleien – erzählen. Diejenigen, die sich »Freiheit«, »Vernunft« und »Toleranz« auf die Fahnen geschrieben hatten, rechtfertigten die Sklaverei in den USA und Ausbeutung in Kolonien rund um den Globus. Es ist jedoch auch nicht schwer zu zeigen, dass sich Liberalismus in der Praxis immer besonders effektiv mit liberalen Ideen kritisieren ließ. Und, weniger offensichtlich, dass die Existenz liberaler Institutionen wie einer freien Presse entscheidend dabei half, dass diese Kritik auch Wirkung zeigte.
Damit soll nicht suggeriert werden, dass Liberalismus – oder auch die liberale Demokratie – früher oder später immer zur Selbstkorrektur fähig sei. Das ist zwar ein beliebter Gedanke, aber diejenigen, die ihn artikulieren, sind sich offenbar nicht immer bewusst, wie sehr er den Eindruck liberaler Selbstgefälligkeit verstärkt. Liberale, so scheint es, würden sich im Zweifelsfall entspannt zurücklehnen und auf den »Fortschritt« warten. Was die Unfreien erleiden müssen, bevor sich der Fortschritt dann endlich einstellt, wird ausgeblendet.
Noch kein Abonnement?
Um diesen Inhalt zu lesen, wird ein Online-Abo benötigt::