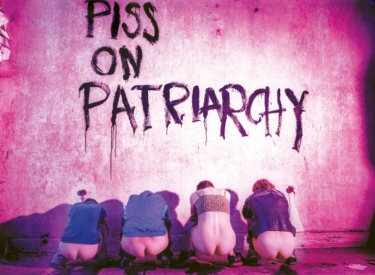Sanktionen allein helfen nicht
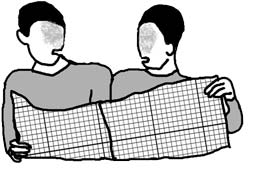 Unter Linken und Feministinnen gibt es seit langem Debatten darüber, wie sexualisierte Gewalt verhindert werden könne und wie, wenn sie doch vorkommt, am besten mit Tätern und Betroffenen umzugehen sei. Diese Diskussionsreihe wirft einen Blick auf den Stand der Debatte.
Unter Linken und Feministinnen gibt es seit langem Debatten darüber, wie sexualisierte Gewalt verhindert werden könne und wie, wenn sie doch vorkommt, am besten mit Tätern und Betroffenen umzugehen sei. Diese Diskussionsreihe wirft einen Blick auf den Stand der Debatte.
In diesem Jahr werden wohl keine großen Festivals stattfinden. Ist damit die Debatte über die sexualisierten Übergriffe auf linken Festivals und in linken Räumen obsolet geworden? Von wegen: Sexualisierte Gewalt gibt es weiterhin und die Zeit muss genutzt werden, um aus Fehlern zu lernen.
Einer dieser Fehler lag darin, wie ein Teil des Organisationsteams von »Monis Rache« die Konzepte Transformative Gerechtigkeit (transformative justice) und community accountability anwandte, wodurch der Täter geschützt wurde, nicht aber die Opfer (Jungle World 8/2020). Diese Konzepte haben das Definitonsmachtprinzip im Umgang mit sexualisierter Gewalt in linken Kreisen abgelöst – eine Folge der Kritik an diesem Prinzip und der Debatten über identitätspolitisch bedingte Ausschlüsse. Die feministische Gruppe e*vibes bietet seit Jahren Workshops zur Definitionsmacht in der linken Szene an. Den Kern von Definitionsmacht sieht sie darin, »dass die Tat-Definition der Betroffenen allgemein anerkannt wird. Dies soll erreicht werden durch parteiliche Verbündete, die diese Definition vertreten.« Die Debatten über Definitionsmacht dauern seit 20 Jahren an. Vielfach wurde kritisiert, dass die Anwendung des Prinzips Sanktionen wie Hausverbote oder Szeneausschlüsse nach sich zog und dass Begriffe wie Gewalt oder Vergewaltigung entleert würden, weil eben die individuelle Definition des Geschehens als Maßstab galt. Obwohl Menschen unterschiedliche Grenzen haben, muss eine Definition von Vergewaltigung allgemein nachvollziehbar sein.
»Community accountability« und »transformative justice« richten sich sowohl gegen den strafenden Staat und gegen Strafrechtsfeminismus als auch gegen linke Sanktionen.
Heutzutage scheint die linke Szene erkannt zu haben, dass Sanktionen nichts geändert haben – sexualisierte Gewalt findet weiterhin statt, wie die Übergriffe bei »Monis Rache« oder die Vergewaltigung im Conne Island im Dezember 2019 zeigten. Obwohl Transformative Gerechtigkeit und community accountability sehr ähnliche Ansätze bezeichnen, haben sie unterschiedliche Entstehungsgeschichten. Inhärent ist beiden Konzepten die Kritik an Gefängnissen, staatlicher Gewalt und Justiz, weil die Polizei Angehörigen diskriminierter Gruppen selten Schutz bietet, sondern eher eine Bedrohung darstellt. Community accountability hat ihre Wurzeln in der queeren und der PoC-Community in den USA, transformative justice hingegen haben in den USA und Kanada christliche Gruppen wie Quäker und Mennoniten geprägt.
In Deutschland arbeiten bereits seit den zehner Jahren die Gruppe Respons und das Transformative-Justice-Kollektiv Berlin mit beiden Methoden aus einer linken Perspektive, doch wurden beide erst in den letzten Jahren bekannter. Community accountability meint kollektive Verantwortungsübernahme: Nicht nur der Gewaltausübende muss sich mit seiner Gewalttat auseinandersetzen, auch die Community, das Umfeld, in dem die Tat passiert ist, trägt Verantwortung. Somit wird die Gewalt nicht individualisiert. Ein Umfeld kann zum Beispiel eine Wohngemeinschaft, ein Verein oder eine politische Gruppe sein. Der Kern von Transformativer Gerechtigkeit ist, dass der Gewaltausübende nicht angezeigt oder bestraft wird, sondern sich mit seinen Taten auseinandersetzen und sich verändern soll. In regelmäßigen Treffen mit einer Gruppe soll er beispielsweise Geschlechterrollen reflektieren. Außerdem vermittelt die Gruppe die Forderungen der Betroffenen und soll dafür sorgen, dass er diese erfüllt. Die Ansätze klingen vielversprechend, um langfristige gesellschaftliche Änderungen zu bewirken, denn es wird sich nur etwas ändern, wenn sich die Täter ändern und Männer beginnen, sich mit patriarchalen Strukturen und Männlichkeit zu beschäftigen.
Beide Konzepte richten sich sowohl gegen den strafenden Staat und gegen Strafrechtsfeminismus als auch gegen linke Sanktionen und versuchen, Alternativen zu entwickeln. Denn Einsperren und Aussperren scheinen zwei Seiten derselben Medaille zu sein. Ein Gerichtsprozess kann Betroffene retraumatisieren und eine Anklage oder gar Verurteilung in Fällen von sexualisierter Gewalt ist selten. Anders als vor Gericht können bei den neuen Methoden Gewaltausübender und Betroffene direkt miteinander ins Gespräch kommen, und die Selbstbestimmung der Betroffenen erhält mehr Gewicht. Das Justizsystem regelt auch nicht unsere Beziehungsweisen. Transformative Gerechtigkeit kann dabei helfen, Lösungen zu finden, wie wir freier leben, lieben und feiern können.
Statt der vielversprechenden Möglichkeiten werden in Deutschland leider sowohl in der Theorie als auch in der Praxis die Probleme beider Vorgehensweisen deutlich. Das liegt nicht zuletzt an der fehlenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung. An deutschen Universitäten wird dazu kaum geforscht und es finden sich gerade einmal zwei linke Buchveröffentlichungen dazu.
Zwar gibt es Gruppen wie LesMigraS, der Antigewalt- und Antidiskriminierungsbereich der Lesbenberatung Berlin, die mit den beiden Ansätzen antirassistisch arbeiten, doch liegt der Schwerpunkt hierzulande weiterhin auf sexualisierter Gewalt. So geht die Kritik am Strafrechtssystem unter. Auch konzentriert man sich hierzulande zu sehr auf den Gewaltausübenden. »Transformative Gerechtigkeit ist darauf ausgelegt, Personen, die Gewalt ausgeübt haben, in ihrem Prozess der Veränderung zu begleiten«, schreiben Respons in ihrem Handbuch. Zum Vergleich: Ruth Morris, eine der führenden christlichen Vertreterinnen der Transformativen Gerechtigkeit in Kanada, stellt die Betroffene in den Mittelpunkt: »Who has been hurt and how can we heal them?«
Wollen Gruppen mit den beiden Methoden arbeiten, erfordert das jahrelange inhaltliche Auseinandersetzung. Transformative Gerechtigkeit und community accountability sollten nicht von Laien angewandt werden. Das Transformative-Justice-Kollektiv Berlin löste sich nach fast zehn Jahren auf, da dessen Mitglieder immer mehr »als Expert*innen gesehen und als Feuerwehr angefragt wurden, um die Prozesse für andere zu führen«. Die Konzepte müssen professionalisiert werden. Vorstellbar wäre dies als Teil der Ausbildung in der Sozialarbeit oder als Weiterbildung. Linke Gruppen sollten sich weiterhin mit diesen Konzepten auseinandersetzen, nur sollten sie eben nicht einen Großteil der praktischen Arbeit leisten, sondern als Vermittlerinnen zu professionellen Stellen fungieren. Wohin es führen kann, wenn Laien versuchen, innerhalb kurzer Zeit mit diesen Verfahren zu arbeiten, hat das Beispiel »Monis Rache« eindrücklich gezeigt: Statt den Betroffenen wurde der Täter geschützt.
Dieser Fall macht auch zwei Probleme deutlich, die der Fokus der Konzepte auf dem kollektiven Umgang anstelle der individuellen Schuld mit sich bringt. Wird dem Umfeld zu viel Mitschuld gegeben, begünstigt dies Selbstjustiz. Einige Personen des Festivalteams, die zuerst von den Vorfällen wussten, erhielten in linken Leipziger Orten ebenso Hausverbote wie der Täter. Sie schützten den Täter, aber sie waren nicht der Täter.
Das zweite Problem liegt darin, Gewalt ausschließlich als etwas Gesellschaftliches und nicht als Resultat von Entscheidungen und Handlungen einzelner Personen zu betrachten, wie es Respons in ihrem Handbuch tun. Dieser Gewaltbegriff entlässt den Täter aus der Verantwortung. Selbstverständlich müssen soziale und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt werden, aber für meine Handlungen bin ich trotzdem selbst verantwortlich.
Die Anwendung Transformativer Gerechtigkeit gilt als langer Prozess, der etwa ein halbes Jahr bis zwei Jahre dauern kann. Im jetzigen Gefängnissystem erhalten die Täter nach Absitzen einer Strafe im Prinzip eine zweite Chance. Aber wer bestimmt das Ende eines Prozesses der Transformativen Gerechtigkeit? Wann ist der Gewaltausübende geläutert? Christliche Vertreterinnen betonen die Vergebung am Ende des Prozesses. Doch kann es diese in Fällen von sexualisierter Gewalt überhaupt geben?
Es sollte in der Linken eine weitere Auseinandersetzung mit Transformativer Gerechtigkeit und community accountability geben, denn trotz ihrer Probleme könnten sie längerfristige Veränderungen ermöglichen als Sanktionen und Ausschlüsse. Wir müssen das Jahr ohne Festivals und Partys nutzen, um an Awareness-Konzepten und an uns selbst zu arbeiten.