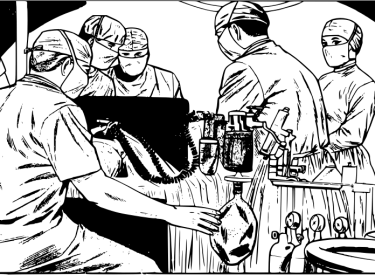Ein Etikettenschwindel
Die ersten Bestrebungen zur Ökonomisierung und Privatisierung der Krankenhäuser in Deutschland gehen bis in die Weltwirtschaftskrise der siebziger Jahre zurück. Nach dem Ende des Nachkriegsbooms hielten in vielen kapitalistischen Gesellschaften neoliberalen Verhältnisse Einzug. Das Kapital suchte neue Anlagemöglichkeiten und wandte sich Bereichen zu, die noch nicht durchkapitalisiert waren. 1984 wurde das bis dahin bestehende gesetzliche Verbot abgeschafft, private Gewinne mit dem Betreiben von Krankenhäusern zu machen. Diese Gesetzesänderung signalisierte Kapitalanlegern, dass hier nun Geschäfte zu machen seien. Es galt jedoch nach wie vor das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip: Grob gesagt wurden die Behandlungskosten der Krankenhäuser, so sie als einer wirtschaftlichen Krankenhausführung entsprechend eingeschätzt wurden, vollständig aus den Pflegesätzen der Krankenkassen und den Investitionszuschüssen der öffentlichen Hand gedeckt.
Davon verabschiedete man sich 1993 mit dem Gesundheitsstrukturgesetz sukzessive und ging zu pauschalierten Entgelten über. Im Jahr 2004 waren dann praktisch die gesamte Krankenhausfinanzierung und alle Abläufe auf sogenannte diagnosebezogene Fallpauschalen und damit auf ein Preissystem mit Markt und Konkurrenz umgestellt. Ziel war die kapitalistische Ökonomisierung des Gesundheitssektors; zudem sollten Krankenhäuser über die Konkurrenz am Markt zum Kostensparen oder sogar zur Schließung gezwungen werden. Die Patienten wurden in sogenannte Diagnosis Related Groups (DRG, diagnosebezogene Gruppen) eingestuft und den Krankenhäusern für ihre Behandlung entsprechende Pauschalen ausgezahlt.
Das Fallpauschalensystem habe sich seit seiner Einführung »so stark verselbständigt, dass der ökonomische Druck zu stark« sei, kritisierte Bundesgesundheitsminister Lauterbach.
Seither müssen die Krankenhäuser wie kapitalistische Unternehmen agieren. Sie müssen auf der einen Seite Kosten einsparen: Das geht vor allem beim Personal und beim Pflegepersonal, weil das die größten Posten sind. Auf der anderen Seite müssen sie auf Gedeih und Verderb Einnahmen generieren. Da im DRG-System nur für behandelte Patienten bezahlt wird und nicht für die Vorhaltung von Personal und Ausstattung, lassen sich die Einnahmen nur steigern, indem man möglichst viele Behandlungen abwickelt. Das kann beispielsweise bedeuten, Operationen vorzunehmen, die medizinisch nicht indiziert sind. Die jährlichen Fallzahlen sind durch dieses Anreizsystem seit 2004 stetig gestiegen, bis sie aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder zurückgingen und bislang auch nicht mehr die Zahlen von 2019 erreicht haben. Gleichzeitig hat sich die Verweildauer der Patienten in Krankenhäusern fast halbiert und die Zahl der Beschäftigten wurde zunächst drastisch gesenkt. Entsprechend hoch ist die Anzahl der Patienten pro Pflegekraft und die Arbeitsbelastung.
Diese Zustände haben bereits lange vor der besonderen Belastung während der Covid-19-Pandemie Arbeitskämpfe provoziert. 2015 gab es an der Charité in Berlin den ersten Streik im Krankenhausbereich, bei dem nicht mehr Lohn, sondern Entlastung des Personals und eine bessere Patienten-Pflegekraft-Quote gefordert wurde. Die Beschäftigten setzten sich mit ihren Forderungen durch, doch kritisierte die Gewerkschaft Verdi bald, dass der ausgehandelte Tarifvertrag seitens der Krankenhausleitung nicht eingehalten worden sei. Entscheidend war jedoch, dass die Streikenden neue demokratischere Formen der Tarifaushandlung entwickelt hatten, indem sie eine Teamdelegiertenstruktur schufen, die bei jedem Schritt der Verhandlungen den Austausch zwischen Beschäftigten und Tarifkommission vermittelte, und so eine Form von Selbstermächtigung der Beschäftigten erreichten, die bundesweit Schule machen sollte.
Im vergangenen Jahr erreichten diese Arbeitskämpfe einen Höhepunkt im elfwöchigen Streik für Entlastung an sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen. Der Streik ging einher mit selbstorganisierten Bildungsaktivitäten. Fast bei allen Krankenhausstreiks der vergangenen Jahre gab es eine sogenannte Streik-Uni mit Workshops zu Themen wie der Ökonomisierung des Gesundheitswesens, der Geschichte der Krankenhausfinanzierung oder zu anderen gesundheitspolitischen und gewerkschaftspolitischen Fragen – und dies in einem Bereich, in dem noch vor kurzem an Streiks nicht zu denken war.
Darauf hatte schon Jens Spahn (CDU), von 2018 bis 2021 Bundesgesundheitsminister, reagieren müssen. Er vollzog eine damals erstaunliche Reform, welche die Pflege am Bett aus der DRG-Logik herausnahm – finanziell machte das circa 20 Prozent des DRG-Volumens in Krankenhäusern aus. Seit 2020 wird die Pflege am Bett, also die Patientenversorgung durch Pflegepersonal im stationären Bereich, nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert, das heißt, die Kosten für Pflege werden auf Nachweis bezahlt. Mit diesen Leistungen Gewinne oder Verluste zu machen, ist so nicht mehr möglich. Das war einerseits ein Paradigmenwechsel in die richtige Richtung – der erste solche Schritt seit Einführung der DRG. Andererseits stieg dadurch der Druck auf die anderen Beschäftigtengruppen im Krankenhaus sogar noch, denn für sie gilt das DRG-System weiter.
Ab 2020 zeigte die Covid-19-Pandemie überdeutlich, dass der durch die Ökonomisierung der Krankenhäuser erzeugte Kostendruck und der Personalmangel auch die Grundversorgung beeinträchtigten. Seither wurden die DRG endlich auch in breiteren Kreisen debattiert und kritisiert. Die Ampelkoalition versprach zwar Verbesserungen für die am meisten durch die DRG benachteiligten Bereiche Pädiatrie, Geburtshilfe und Notaufnahmen, aber am DRG-System an sich wollte sie nicht rütteln, sondern nur »Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung« vorlegen, die das bisherige System »um ein nach Versorgungsstufen differenziertes System erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen ergänzt«, wie es im Koalitionsvertrag hieß.
Am 23. Oktober kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dennoch an prominenter Stelle im »ZDF Heute Journal« an, dass die von ihm eingesetzte »Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung« an einem Konzept für eine »Überwindung der Fallpauschalen« arbeite. Das Fallpauschalensystem habe sich seit seiner Einführung, an der Lauterbach als damals für Gesundheitspolitik zuständiges Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion selbst beteiligt gewesen war, »so stark verselbständigt, dass der ökonomische Druck zu stark« sei. Von »Daseinsvorsorge« war plötzlich wieder die Rede; der von Kritikern des Systems gebrauchte Vergleich mit der Feuerwehr, die schließlich auch bezahlt werde, wenn es nicht brennt, wurde plötzlich nicht mehr ignoriert oder belächelt, sondern zustimmend aufgegriffen. Ein paar Tage später nahm Lauterbach in einer Talkshow für seine Pläne gar das Wort »Revolution« in den Mund. Etwas nüchterner sprach er dann von einer »dramatischen Entökonomisierung der Krankenhäuser«. Doch das ist ein großer Etikettenschwindel.
Am 6. Dezember stellte Lauterbach das Papier der 17köpfigen Expertenkommission der Öffentlichkeit vor, das maßgeblich von den bekannten neoliberalen Ökonomen Boris Augurzky und Reinhard Busse verfasst worden war. Es sieht ein Konzept von drei Versorgungsstufen und eine Aufteilung in Leistungsgruppen vor. Doch darin stecken weder Entökonomisierung noch gar Revolution; DRG-Vergütungen sollen lediglich in einer Höhe von 20 Prozent der bisherigen DRG-Erlöse beziehungsweise von 40 Prozent für Intensivmedizin, Notfallmedizin, Geburtshilfe und Neonatologie durch eine sogenannte Vorhaltevergütung ersetzt werden. Diesen Anteil ihrer Vergütung sollen die Krankenhäuser in Zukunft angeblich unabhängig von der Fallmenge und Fallart erhalten.
Die Umstellung soll über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen, in dem der Anteil der Vorhaltevergütung langsam angehoben wird. Die Gesamtvergütung soll so am Ende gleich bleiben, sie wird nur teilweise in anderer, fall- und diagnoseunabhängiger Form ausgezahlt.
Im Gegensatz zu den Geldern für die Pflege am Bett handelt es sich bei diesen sogenannten Vorhaltepauschalen aber nicht um eine wenigstens teilweise Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip, bei der die Kosten der Vorhaltung voll übernommen werden. Mit den Vorhaltepauschalen werden die tatsächlichen Vorhaltekosten nicht vollständig finanziert, sondern die Auszahlung wird selbst wieder nach einer komplizierten und zum Teil widersprüchlichen Systematik zum Teil an die DRG-Volumina, zum Teil an Leistungsmengen gebunden. Das Versprechen, die Finanzierung der Versorgung unabhängig von Fallmengen zu machen und damit die ökonomischen Anreize mit ihren verheerenden Folgen zu beenden, kann die Reform also nicht einlösen. Sogar Gewinne lassen sich mit diesen Vorhaltepauschalen erzielen. Abgeschafft werden die DRG nicht, sondern sollen nach wie vor den Großteil der Vergütungen ausmachen.
Die Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern, die Preisanreize, die Profite, der Kostendruck, die privaten Krankenhauskonzerne – alles bleibt erhalten. Für eine echte Revolution in den Krankenhäusern brauch es also nach wie vor weitere und verschärfte Arbeitskämpfe der Beschäftigten.

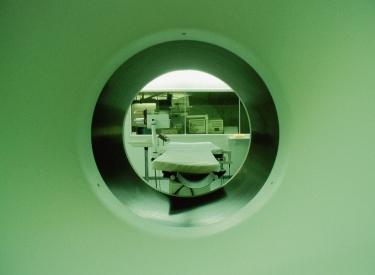
 Profitorientierter Notstand
Profitorientierter Notstand