Pluralität als Mantra
Die Pose beherrscht er seit langem bestens. Als junger, wütender Publizist und Lyriker hat sich Max Czollek bereits mit seinen Büchern »Desintegriert Euch!« (2018) und »Gegenwartsbewältigung« (2020) einen Namen im hiesigen Kulturbetrieb gemacht. Stets polemisierte er dabei gegen eine postnazistische Gesellschaft, die ihre Weltoffenheit und Vergangenheitsbewältigung wie eine Monstranz vor sich herträgt und sich dabei ständig selbst feiert. Und weil aller guten Dinge bekanntermaßen drei sind, folgt nun eine weitere Streitschrift, diesmal unter dem Titel »Versöhnungstheater«.
Darin attestiert Czollek der Mehrheit der Biodeutschen, dass es mit all dem Gedenken und Aufarbeiten, das der Geschichte zwischen 1933 und 1945 gewidmet wird, so eine Sache sei. Denn im Allgemeinen erfolge dies nicht ehrlich und aufrichtig, vielmehr gehe es um eine Art Selbstbespiegelung. Und da nach 1945 sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR der vormalige Besitz eines braunen Parteibuchs seltenst einen Karriereknick zur Folge hatte und nur ein Bruchteil der für die Shoah oder für Kriegsverbrechen Verantwortlichen vor Gericht landete, sei das mit der Erinnerungskultur ohnehin ein Hohn. Deshalb unterstellt Czollek allen Beteiligten ein instrumentelles Verhältnis zu den Opfergruppen – insbesondere zu den Juden.
»Bedenkt man, dass die unterschiedlichen Phasen der Erinnerungskultur so gut wie keine Auswirkungen auf die Strafverfolgung hatten, erscheint die Erinnerungskultur in einem anderen Licht – als staatlicher und gesellschaftlicher Ausdruck guten Willens nämlich, der die Inszenierung der eigenen Wiedergutwerdung erlaubte, ohne die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu müssen«, so Czollek.
Was Czollek schreibt, ist im Prinzip schon vor Jahrzehnten von anderen konstatiert und dargestellt worden.
Dummerweise erfährt man erst irgendwann auf Seite 92, nachdem das Wort »Wiedergutwerdung« bereits einige Male gefallen ist, ganz beiläufig, dass dieser in der Streitschrift so zentrale Begriff keine Eigenkreation ist, sondern von dem 1997 verstorbenen Publizisten und Essayisten Eike Geisel stammt, der sich natürlich nicht mehr dagegen wehren kann, dass sich jemand seinen Begriff so unverblümt zu eigen macht.
Denn das, was Czollek schreibt, ist im Prinzip schon vor Jahrzehnten von anderen konstatiert und dargestellt worden, allen voran eben von besagtem Eike Geisel, aber auch von Wolfgang Pohrt oder Henryk M. Broder (bevor dieser rechts vom Pferd gefallen ist und mit Alice Weidel auf Tuchfühlung ging). Nicht zuletzt deshalb gibt es bei der Lektüre ein Déjà-vu nach dem anderen, wenn man Sätze wie beispielsweise diesen liest: »Beim Versöhnungstheater leisten die hier lebenden Juden und Jüdinnen eine Art ideologische Arbeit, um die sich erinnernde deutsche Seite ihrer guten Absichten zu versichern.«
Recyceln von bereits Bekanntem
Das klingt sehr nach dem Recyceln von bereits Bekanntem. Nur eben waren Autoren wie Geisel, Pohrt oder Broder allesamt am Materialismus geschult und zur Analyse fähig, was einen qualitativen Unterschied zu Czollek ausmacht. Darüber hinaus ging es ihnen, beispielsweise Eike Geisel in seinem Essay »Die Verstaatlichung der Juden«, darum, seine pointierte Kritik ohne Rücksichtnahme auf linke Befindlichkeiten zu formulieren.
Um genau die geht es Czollek aber eigentlich. Sehr deutlich wird das an einer Stelle in »Versöhnungstheater«, in der er ohne größere Not sich plötzlich mit der Kritik an linker Identitätspolitik beschäftigt und davon spricht, dass dabei eher diejenigen, die auf eine Veränderung gesellschaftlicher Strukturen und Praktiken drängen, als Gefahr betrachtet würden und nicht die realen Diskriminierungsformen oder die Gewalt von rechts. Entsprechend vehement verteidigt er diese Identitätspolitik dann auch. »Das Ziel einer solchen ›Diskriminierungskritik von Links‹ ist vielleicht gerade, das eigene politische Handeln auch reflexiv auf ein Niveau zu bringen, das fortan nicht nur die Rechte und Bedürfnisse mancher, sondern aller Menschen im Blick hat«, so seine Sicht der Dinge.
Irgendwann entsteht der Eindruck, dass Czollek zu den Irrungen und Wirrungen deutscher Erinnerungspolitik nur ein instrumentelles Verhältnis hat.
Leider ist das alles etwas schlicht und blendet komplexere Zusammenhänge ebenso aus wie die Tatsache, dass arme Schweine eben auch Schweine sein können, sprich: Angehörige von Minderheiten oder marginalisierten Gruppen sich anderen gegenüber ebenfalls manchmal unfein verhalten. Aber das passt nicht in Czolleks Weltbild. Exemplarisch zeigt sich das, wenn er Ralph Giordano als Musterbeispiel einer entschiedenen jüdischen Solidarität mit den Opfern struktureller Gewalt erwähnt.
In einem Nebensatz watscht er den 2014 verstorbenen Journalisten aber gleichzeitig dafür ab, dass er »später anlässlich eines Moscheebaus in Köln politisch die Orientierung« verloren habe. Wenn die Kritik an der hochproblematischen, weil homophoben, türkisch-nationalistischen und Juden nicht unbedingt freundlich gesinnten Ditib und dem von ihr initiierten Moscheebau in Köln, für die Giordano zudem Morddrohungen erhielt, in der Wahrnehmung eines Max Czollek bereits ein No-Go ist, dann sieht es mit seiner eigenen Fähigkeit zur Solidarität nicht wirklich gut aus, dann ist sie selektiv.
Nervige Klezmermusik
Wie bereits in seinen beiden vorigen Büchern sind die Begriffe Vielfalt und Pluralität Czolleks eigentliches Mantra – oder wahlweise seine heiligen Kühe. Es ist eine Binse, dass das jüdische Leben in Deutschland heutzutage diverser ist als die inflationär in den Fernsehbeiträgen zum Thema zu sehenden Kippaträger, wobei zumeist auch noch nervige Klezmermusik eingespielt wird.
Aber irgendwann entsteht der Eindruck, dass Czollek zu den Irrungen und Wirrungen deutscher Erinnerungspolitik ebenfalls nur ein instrumentelles Verhältnis hat, wenn er sein Modell von Vielfalt und Pluralität propagiert, das selbst nicht ohne Verklärung und Kitsch auskommt. »Was würde es also bedeuten, die Erinnerungskultur so einzurichten, dass das erinnernde, trauernde und gestaltende Wir nicht nur deutsch, sondern auch jüdisch ist? Und nicht nur jüdisch, sondern auch postmigrantisch, hetero, Schwarz, westdeutsch, bürgerlich vietnamesisch, mit einer spezifischen körperlichen und psychischen Verfasstheit und so weiter?«
Gute Frage, eine Antwort hat er aber nicht wirklich parat. Sie könnte ähnlich wie die Bestellseite bei Lieferando aussehen, wo für jeden Geschmack das richtige Essen angeboten wird. Nur kommt es zumeist lauwarm und matschig an.

Max Czollek: Versöhnungstheater. Hanser-Verlag, München 2023, 175 Seiten, 22 Euro




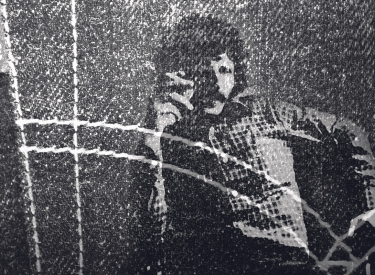
 Der intellektuelle Grenzgänger
Der intellektuelle Grenzgänger


