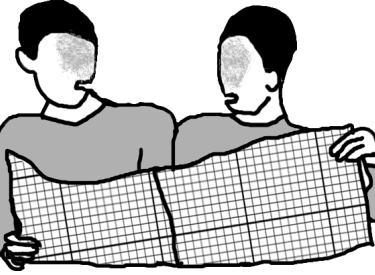Richtiges Kleben im Falschen
Die Bilder aus Lützerath sind um die Welt gegangen. Die Räumung der Protestcamps dürfte nicht nur die Klimakrise befeuern, sondern auch die Abkehr der hiesigen Klimabewegung von der Regierungspolitik, speziell den Grünen, beschleunigen. Bei aller berechtigten Kritik, die Mira Landwehr und Jörn Schulz an dieser Stelle bereits an der Klimabewegung geübt haben, sollten drei Dinge nicht vergessen werden: erstens – wie Peter Bierl bereits zum Auftakt der Debatte feststellte –, dass die emanzipatorische Linke ihrerseits bisher wenig zu bieten hat, was der ökologischen Krise gerecht würde; zweitens, dass es die jungen Klimaaktivist:innen waren, die das Thema in seiner Brisanz überhaupt erst in die öffentliche Debatte gehievt haben; und drittens, dass die junge Bewegung in vergleichsweise kurzer Zeit bereits eine enorme Entwicklung mit wichtigen Erkenntnisgewinnen durchlaufen hat. Sie hat in und durch ihre eigene Praxis gelernt. Beispielsweise, dass der bloße Appell an die Mächtigen, doch bitte auf die Wissenschaft zu hören, nutzlos ist. Oder dass es bei weitem nicht ausreicht, vor allem den eigenen Konsum oder ökologischen Fußabdruck zu hinterfragen.
Nur in Kämpfen um konkrete Maßnahmen könnte man die Grenzen dieser Gesellschaftsordnung austesten und überschreiten.
Jede Bewegung hat ihre eigenen Dynamiken und lebt von ihren Lernprozessen. Dass diese Entwicklungen im Eifer des Gefechts nicht geradlinig verlaufen können, sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Das Festkleben im Straßenverkehr und die Tumulte in Museen haben tatsächlich etwas kamikazehaftes an sich, keine Frage. Bei allem Verständnis für die Ungeduld und die Verzweiflung der Akteure bleibt fragwürdig, ob diese Aktionsorte die richtigen sind. Aber immerhin gab es zuletzt auch Aktionen vor Parteizentralen, gegen die Auswüchse der Fast Fashion bei der Berliner Fashion Week sowie gegen Privatjets auf dem Berliner Flughafen Schönefeld. Und auch konkrete Forderungen, die das zu abstrakte 1,5-Grad-Ziel untermauern sollen, gehören längst zum Repertoire der Bewegung – ob das Abschalten von Kohlemeilern, die Ablehnung des Braunkohletagebaus bei Lützerath oder die Forderung nach einem dauerhaften Neun-Euro-Ticket.
Der Versuch, radikale Aktionsformen mit konkreten Forderungen in Einklang zu bringen, ist durchaus vielversprechend. Schließlich ist jede Tonne CO2, die nicht in die Luft geblasen wird, ein kleiner Erfolg. Dass die kapitalistische Produktionsweise die ökologische Krise dauerhaft nicht in den Griff bekommen kann, ist das eine. Dass trotz dieser zentralen Erkenntnis aber sofort Maßnahmen und Fortschritte notwendig sind, das andere.
Diese beiden Einsichten schließen einander nicht aus. Wer das Patriarchat überwinden will, sollte das Frauenwahlrecht als großen Fortschritt feiern. Wer das Lohnsystem ablehnt, sollte trotzdem den Achtstundentag verteidigen. Banalitäten eigentlich, die man radikalen Linken aber anscheinend wieder ins Gedächtnis rufen muss.
Also richtiges Kleben im Falschen? Das ist zumindest besser als die Weisheit der Resignierten. Der bloß verbalradikale Verweis auf die Notwendigkeit einer vom Kapitalverhältnis befreiten Gesellschaft ist in Anbetracht der derzeitigen Kräfteverhältnisse lächerlich. Vielmehr gilt es, hier und jetzt konkrete Maßnahmen zu entwickeln und in die Debatte zu bringen, die das drohende Erreichen der Kipppunkte im Klimasystem der Erde noch verhindern könnten. Ausgangspunkt der Argumentation sollten dabei die materiellen Gegebenheiten sein, letztlich die systemischen Grenzen, die der Planet setzt.
Ob Mira Landwehr der Begriff des »Kohlenstoff-Budgets« nun gefällt oder nicht – trotz der Kritik an der Politik, die mit »dem Budget« gemacht wird, geht es letztlich genau darum: um eine naturwissenschaftlich abschätzbare Menge CO2, die noch emittiert werden kann, bevor Kaskadeneffekte der Erderwärmung drohen. Diese objektiven Verhältnisse sollten zum Dreh- und Angelpunkt einer emanzipatorischen Programmatik werden. Da eine solche per Definition den Anspruch haben muss, mehrheitsfähig zu werden, dürften die zu fordernden Maßnahmen vermutlich recht schnell an die Grenzen der Klassengesellschaft und ihrer Eigentumsordnung stoßen.
Sinn und Zweck einer demokratischen Planwirtschaft sollten in einem Lernprozess erfahrbar werden, stellte Jörn Schulz hier vergangene Woche fest. Damit diese Idee nicht ihrerseits zur Phrase wird, folgen ein paar erste Vorschläge, wie man die Diskussion konkretisieren könnte.
Die Verkehrswende dürfte nicht bei strikten Tempolimits und einem günstigen ÖPNV stehenbleiben, sondern müsste Verkehrsbetriebe und Bahnen komplett in öffentliches Eigentum überführen. Diese Maßnahme sollte mit einem starken Ausbau der Kapazitäten, speziell der Reaktivierung von stillgelegten Strecken, einhergehen. Statt innereuropäischen Flugverkehrs bräuchte es neue Schnellzugstrecken durch Europa. Öffentliche Kontrolle der Automobilkonzerne könnte die bislang besonders profitable Produktion von SUVs und schweren PKW beenden.
Zur Senkung des Energieverbrauchs kann man auf Produktionsprozesse und nutzlose Produkte verweisen. Hier zeigt sich die Destruktivität der Kapitalakkumulation. Zum Beispiel werden tagtäglich enorme Mengen an Kunststoff, Papier und Glas weggeschmissen. Dabei wäre es ein leichtes, Verpackungsmengen durch eine strikte Pfand- und Normierungspflicht drastisch zu reduzieren oder Einwegverpackungen zu verbieten. Das gilt sowohl für Plastik- als auch für Glasbehälter, gerade im Endverbrauch. Auch Papier wird massenhaft für überflüssige Werbung und einen katastrophal schlecht koordinierten Versandhandel verschwendet. Enorme Mengen an Energie und Material könnten hier eingespart werdenkönnten. Warum nicht strikte Gesetze und Normen ohne Ausnahmen einfordern?
Um den schnellen Ausbau von regenerativen Energien zu garantieren, reicht es nicht, ein Ende der Abstandsregeln bei Windrädern zu fordern. Für jedes Dach könnte man eine Photovoltaikanlage verlangen, und sei es gegen den Willen der Eigentümer. Die Gewinne sollten bei den Kommunen verbleiben, verwaltet von demokratisch kontrollierten, gemeinwohlorientierten Stadtwerken. Zusätzlich müsste sofort begonnen werden, das gesamte Stromnetz so umzubauen, dass es den Anforderungen einer vollständig erneuerbaren Energieproduktion genügen kann.
Dem derzeit überall beklagten Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten könnte man durch die Forderung nach Priorisierung und Steuerung begegnen. Hier könnte man verdeutlichen, was Planung leisten müsste. Knappe Halbleiter dürften nicht mehr für Autos vergeudet werden. Viel zu dringend werden sie für die Produktion von Wärmepumpen, Wechselrichtern für Solarenergie und dergleichen mehr benötigt. Auch würde die Herstellung von Kühlmittel- gegenüber der von Benzinpumpen nur dann priorisiert, wenn es gesamtgesellschaftlich beschlossen und durchgesetzt würde. Neben Großfabriken für Wärmepumpen statt für Teslas bräuchte es Wärmenetze und Geothermie in den Städten, dazu Gebäudedämmungen durch industrielle Verfahren und Vorfertigung.
Die Ursache der derzeit viel zu langsamen Umgestaltung sind nicht, wie oft behauptet, fehlende Materialien oder Fachkräfte, sondern die Eigentumsverhältnisse und die Marktgesetze. Diesen Aspekt müsste man mit konkreten Vorschlägen in den Vordergrund rücken und dabei die sozialen Konsequenzen betonen. Umbaumaßnahmen müssten folglich so eingefordert werden, dass sie nicht dazu genutzt werden könnten, Gewinne zu generieren – etwa durch höhere Mieten, Verdrängung von Mietern oder niedrigere Löhne. Vielmehr müssten sie zu Lasten der Besitzenden durchgesetzt werden. Es ginge um kollektive Planungs- und Aneignungsprozesse, die lokale Umsetzung und Selbstverwaltung mit zentraler Koordinierung verbinden. Solange die Strukturen der Profitmaximierung Bestand haben, ist das schwierig, keine Frage.
Der wohl wesentlichste Punkt für ein industrielles Umbauprogramm und dessen breite Akzeptanz dürfte die Frage nach der gesamtgesellschaftlich notwendigen Arbeit und ihrer Verteilung werden. Unter den derzeitigen Voraussetzungen haben die Lohnabhängigen oft ein unmittelbares Interesse daran, die Branchen, in denen sie tätig sind, zu verteidigen – und seien sie noch so nutzlos und ökologisch fatal. Aus diesem Dilemma könnte man entkommen, wenn man die Frage der Arbeitsverteilung gesamtgesellschaftlich aufwirft. Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung sollte eine zentrale Forderungen werden.
Eine Programmatik, die solche und ähnliche konkreten Forderungen erhebt, könnte es ermöglichen, dass eine sich radikalisierende Klimabewegung und eine emanzipatorische Linke zusammenfinden. Mit der Marktmacht der Konzerne ist eine solche Perspektive kaum zu vereinbaren. Sollten erste Forderungen verwirklicht werden, würde man wohl schnell in Konflikt mit Eigentumsordnung und Profitlogik geraten. Wie das aussähe, würde sich zeigen. Aber nur in Kämpfen um konkrete Maßnahmen könnte man die Grenzen dieser Gesellschaftsordnung austesten und überschreiten. Die Vergesellschaftungsperspektive wäre dann keine Monstranz mehr, die man dogmatisch vor sich her trägt. Sie würde zur logischen Konsequenz aus gemeinsamen Auseinandersetzungen um konkrete Ziele. In solchen Kämpfen würde deutlich werden, dass der kapitalistische Imperativ des »immer größer« und »immer mehr« zwangsläufig einen ökologischen Kollaps heraufbeschwört.
Die Aufregung über die »Klima-Kleber« hält an. Alexander Dobrindt (CSU) warnte im November 2022 vor der »Klima-RAF«, einige Aktivisten wurden in Bayern für mehrere Tage in Präventivhaft genommen. Dem Aktionismus fehlt eine Kapitalismuskritik, ist das Anliegen deshalb zu verwerfen? Es wäre die originäre Aufgabe für Linke, eine kapitalismuskritische Antwort auf den Klimawandel zu formulieren, meint Peter Bierl (50/2022). Mira Landwehr forderte die Klimabewegung auf, sich einen Begriff vom Gesellschaftssystem zu machen (2/2023). Jörn Schulz kritisierte, dass sie keine Umgestaltung der Produktionsverhältnisse fordere (3/2023).