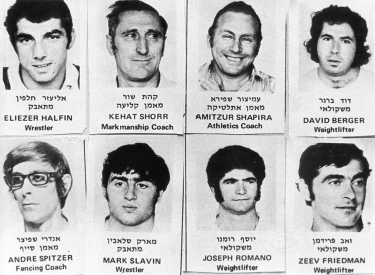Die neue antisemitische Realität
Mit dem 7. Oktober begann für viele Jüdinnen und Juden eine neue Zeitrechnung: Ihr Leben teilt sich seitdem in ein Davor und ein Danach. Der Tag, an dem die Hamas Israel angegriffen hat, bedeutet eine Zäsur für jüdisches Leben – nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland, wo der Antisemitismus rasant zunimmt.
Viele Jüdinnen und Juden verzichten seither darauf, sich in der Öffentlichkeit als jüdisch erkennbar zu machen. »Ein offenes, selbstverständliches und vor allem unbeschwertes jüdisches Leben ist in Deutschland seit dem 7. Oktober noch weniger möglich als zuvor«, sagt Marco Siegmund, Pressesprecher des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias), der Jungle World.
Rias erfasste im vergangenen Jahr fast 83 Prozent mehr antisemitische Vorfälle als noch im Vorjahr. 2022 waren es 2.616, 2023 dagegen 4.782. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Recherchestelle am 25. Juni 2024 veröffentlichte. Der heftige Anstieg ist demnach maßgeblich auf antisemitische Vorfälle nach dem 7. Oktober zurückzuführen: 2.787 waren es seitdem bis zum Jahresende, damit fielen über 58 Prozent aller Vorfälle des Jahres in dessen letzte drei Monate. Rechnerisch waren es 32 Vorfälle pro Tag.
Rias erfasste im vergangenen Jahr fast 83 Prozent mehr antisemitische Vorfälle als noch im Vorjahr.
Der 7. Oktober wird daher im Bericht als Gelegenheitsstruktur bezeichnet, also ein Ereignis, das zu einem starken Anstieg antisemitischer Vorfälle beitragen kann. Der Überfall der Hamas auf Israel ist nicht der Grund für antisemitische Taten, sondern bietet einen Rahmen, macht solche Taten wahrscheinlicher. Rias verzeichnet nicht nur einen plötzlichen und sehr starken Anstieg, sondern zudem eine Zunahme von besonders gewalttätigen Vorfällen. »Rund zwei Drittel aller Fälle von extremer Gewalt, Angriffen und Bedrohungen fanden nach dem 7. Oktober statt«, so Siegmund. »Dazu zählen Brandanschläge auf das Haus einer jüdischen Familie im Ruhrgebiet und auf ein Gemeindezentrum in Berlin.«
Genozidale Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Israel
Die Zunahme antisemitischer Vorfälle nach dem 7. Oktober ist dem Bericht zufolge ungleich stärker als bei vergleichbaren Gelegenheitsstrukturen. Dabei hat es nicht einmal Israels Maßnahmen zur Selbstverteidigung gebraucht. Bereits unmittelbar nach den Massakern der Hamas vermehrten sich dem Bericht zufolge die antisemitischen Taten. Demnach habe die genozidale Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Israel, also das Töten und Misshandeln als Selbstzweck ohne eine anderweitige Scheinbegründung, Menschen hierzulande in besonderem Maße dazu motiviert, antisemitisch zu handeln.
Zudem zeigt sich ein Umstand, der bereits in der Vergangenheit beobachtet werden konnte: Jüdinnen und Juden werden mit Israel gleichgesetzt und für das Vorgehen der israelischen Regierung oder der Armee verantwortlich gemacht. Als Beispiel nennt der Bericht einen Vorfall in einer Kölner Schule Mitte Oktober. Mehrere Schülerinnen und Schüler hätten im Unterricht gesagt, »die Juden« hätten den Krieg provoziert, seien »Mörder« und trügen die Verantwortung für das, was »in Palästina« passiere. Generell stünden sie hinter den meisten Kriegen, weil sie damit Geld verdienten. Und bei einer israelfeindlichen Demonstration in Bremen habe ein Teilnehmer gesagt: »Dieses Land« – Deutschland – »ist erst frei, wenn alle Juden für immer aus allen Ländern verschwunden sind.«
Der Antisemitismus prägt den Alltag deutscher Jüdinnen und Juden. Häufige Tatorte sind dem Bericht zufolge solche, die Betroffene in ihrem Alltag regelmäßig aufsuchen und nicht meiden können. 46 Prozent aller Vorfälle finden demnach im öffentlichen Raum statt, und auch im eigenen Wohnumfeld ist eine Zunahme zu beobachten.
Unsicherheit im öffentlichen Raum, Angst um die Zukunft jüdischer Kinder
In Freiburg beispielsweise sei ein jüdischer Geflüchteter aus der Ukraine in seiner Unterkunft von einem Zimmernachbarn über Monate antisemitisch bedrängt worden. Es gebe »zu viele von euch Juden«, habe der Mann gesagt. Der Betroffene könne froh sein, dass er ihm noch nichts angetan habe. Rias spricht von einer »täglich spürbaren Belastung« für Juden, was das private, aber auch das organisierte jüdische Leben in Deutschland unmittelbar verändert habe.
Bei einer Umfrage des Zentralrats der Juden in Deutschland unter den jüdischen Gemeinden gaben im Dezember 78 Prozent an, ihr Leben als Juden in Deutschland habe sich verändert. Von Unsicherheit im öffentlichen Raum, Angst um die Zukunft jüdischer Kinder und die Sorge um die Perspektive jüdischen Lebens hierzulande wird berichtet. 68 Prozent geben an, dass sich der Krieg negativ auf die Gemeinden auswirke, man Angst vor Angriffen habe und weniger Besucher verzeichne.
»Die jüdische Gemeinschaft erkennt den alten Hass im neuen, mehrheitsfähigen Gewand wieder.« Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland
»Seit den in Teilen relativierenden, verherrlichenden oder ausbleibenden Reaktionen auf den 7. Oktober hat sich der moralische Standard verzerrt«, teilt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, der Jungle World mit. »Die jüdische Gemeinschaft erkennt den alten Hass im neuen, mehrheitsfähigen Gewand wieder.« Er fordert eine Anpassung des Strafrechts, »wenn antisemitische und antizionistische Gruppen die Vernichtung des Staats Israels fordern«. Dann nämlich sei »längst eine Grenze überschritten«. Der Antisemitismusbeauftrage des Bunds, Felix Klein, sagt der Jungle World, »der Aufruf zur Vernichtung anderer Staaten« sollte »unter Strafe gestellt werden«.
»Jüdinnen und Juden erleben ihre Umgebung als feindlich und große Teile der Zivilgesellschaft und der engagierten Wissenschaft in den schwierigsten Zeiten vor allem als empathielos und unsolidarisch«, so Siegmund. Wichtig sei es daher, Antisemitismus in all seinen Formen konsequent entgegenzutreten. Auch er sieht dabei politisch Verantwortliche und Strafverfolgungsbehörden in der Pflicht. »So ist es dem Bundestag auch nach acht Monaten nicht gelungen, sich auf einen gemeinsamen interfraktionellen Entschließungsantrag zur Bekämpfung des Antisemitismus nach dem 7. Oktober zu einigen.«



 Feindliche Übernahme gescheitert
Feindliche Übernahme gescheitert