Informationen verhüten
Der Neuentwurf eines »Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch« bietet keinen Grund zur Freude, sondern ist ein Ausdruck der Rechtsentwicklung der vergangenen Jahre. Bisher prägte eine Uneindeutigkeit den Gesetzestext, die erst durch die Welle von Anzeigen rechter Abtreibungsgegner und die Neigung der Staatsanwaltschaften, diese Fälle zur Anklage zu bringen, zum Problem wurde. Dem Entwurf zufolge soll es Ärztinnen und Ärzten gestattet sein, das Wort »Schwangerschaftsabbruch« auf ihren Websites zu erwähnen. Sie würden dann in Listen geführt, die Abtreibungsgegner zum Zusenden von Plastikföten einlüden, bemerkt Dinah Riese in der Taz.
»Werbende Handlungen bleiben weiterhin verboten«, steht im Gesetzentwurf. »Damit passt sich die Regelung in das bestehende gesetzgeberische Schutzkonzept für das ungeborene Leben ein.«
Es sollte nicht vergessen werden, dass der Schutz »ungeborenes Lebens« vor allem dem der Norm entsprechenden Leben gilt. Es herrscht eine Doppelmoral: Wenn durch Pränataldiagnostik klar wird, dass kein optimales Kind zu erwarten ist, besteht eher gesellschaftlicher Druck, die Schwangerschaft abzubrechen.
Das ist ein klarer Sieg für die Abtreibungsgegner. Die CDU hatte angekündigt, keinesfalls von diesem »Schutzkonzept« abzuweichen, und hat das auch durchgesetzt. Die SPD stellt das als Kompromiss dar, nun herrsche Rechtssicherheit. »Ja, die herrscht jetzt«, schreibt Barbara Vorsamer in der Süddeutschen Zeitung, »mit Sicherheit ist das Informieren über Abtreibungen künftig illegal.«
Nach wie vor gibt es viele Orte in Deutschland, an denen gar keine Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, und Studierende müssen sich manchmal selbst organisieren, um die medizinischen Methoden überhaupt zu erlernen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass nicht mehr darüber informiert werden darf, wie ein Abbruch ausgeführt würde: ob etwa mit Medikamenten oder operativ. Die Gynäkologin Nora Szász, nach dem alten Paragraph 219a StGB angeklagt, plant weiterhin, über ihre Anwendung von Mifegyne, einem Medikament für den Schwangerschaftsabbruch, zu informieren. »Ich möchte die Frauen mit den medizinischen Details versorgen, die ich für nötig halte«, sagte sie der Taz.
Mythen, die zur Beschuldigung und Bevormundung von Frauen beitragen, werden derweil gefördert. Der Mythos »Hätte sie halt verhütet« wird dadurch fortgeschrieben, dass zugleich mit der Vorstellung des Gesetzentwurfs beschlossen wurde, dass die Antibabypille bis zum Alter von 22 Jahren von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Und auch der Mythos »Abtreibung ist immer eine seelische Wunde« soll bestehen bleiben, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine Studie seines Ministeriums zu »seelischen Folgen« des Abbruchs in Auftrag gegeben. Denn die Bevormundung der Frau ist erst dann komplett, wenn nicht nur das »ungeborene Leben«, sondern auch sie selbst vor ihren eigenen Entscheidungen geschützt wird. Es ist gut dokumentiert, dass die überwiegende Mehrheit der betroffenen Frauen nach einiger Zeit nur noch Erleichterung verspürt. Wer dazu bei den staatlichen Informationsangeboten überraschenderweise nicht fündig werden sollte, der sei beispielsweise das Buch »Happy Abortions« von Erica Millar ans Herz gelegt.
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass der Schutz »ungeborenes Lebens« vor allem dem der Norm entsprechenden Leben gilt. Es herrscht eine Doppelmoral: Wenn durch Pränataldiagnostik klar wird, dass kein optimales Kind zu erwarten ist, besteht eher gesellschaftlicher Druck, die Schwangerschaft abzubrechen. Tatsächlich scheint plausibel, dass Abbrüche nicht zuletzt deshalb straffrei bleiben, um die »Belastung« durch Kinder mit Behinderungen gering zu halten. Die freie Entscheidung der unfreiwillig schwangeren Person steht offenkundig nicht im Vordergrund.
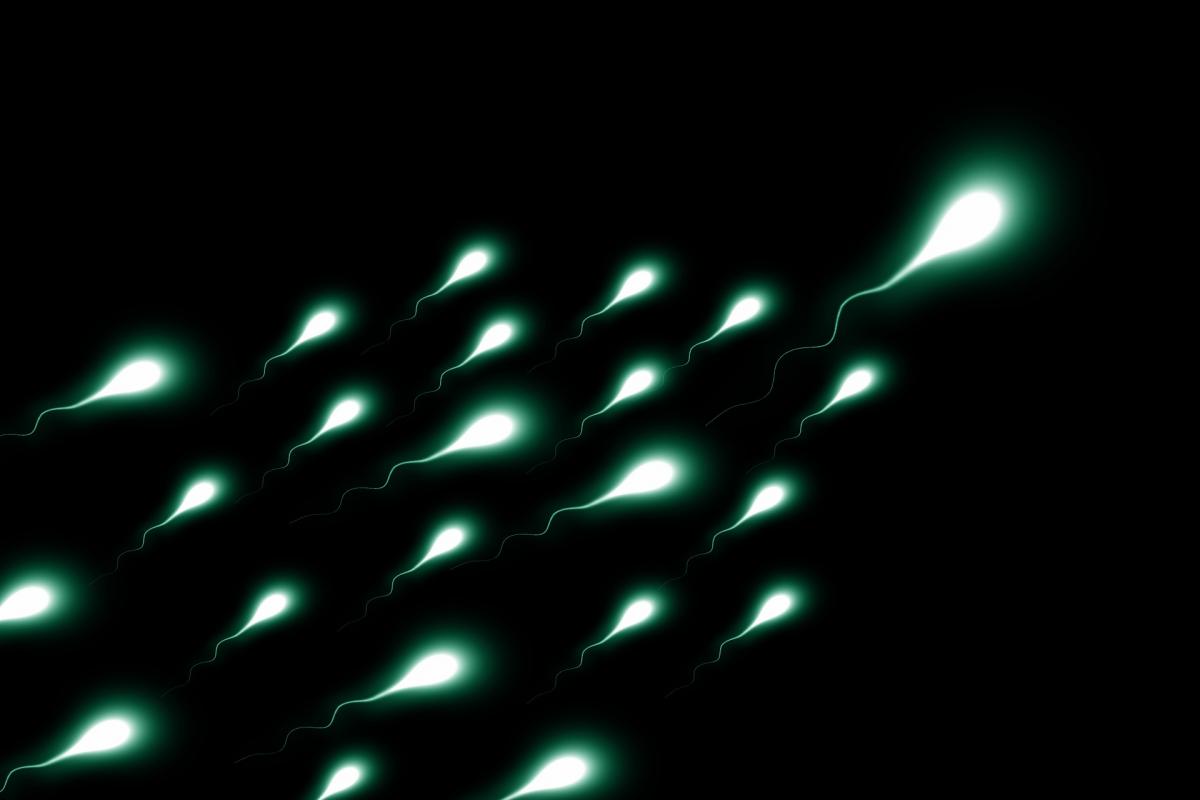





 »Compact«-Verbot: Die Angst geht um
»Compact«-Verbot: Die Angst geht um
