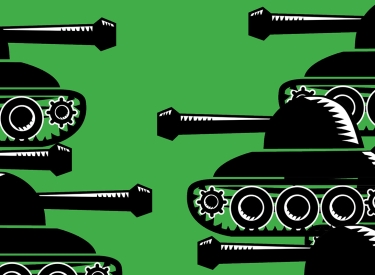Russland dekolonisieren
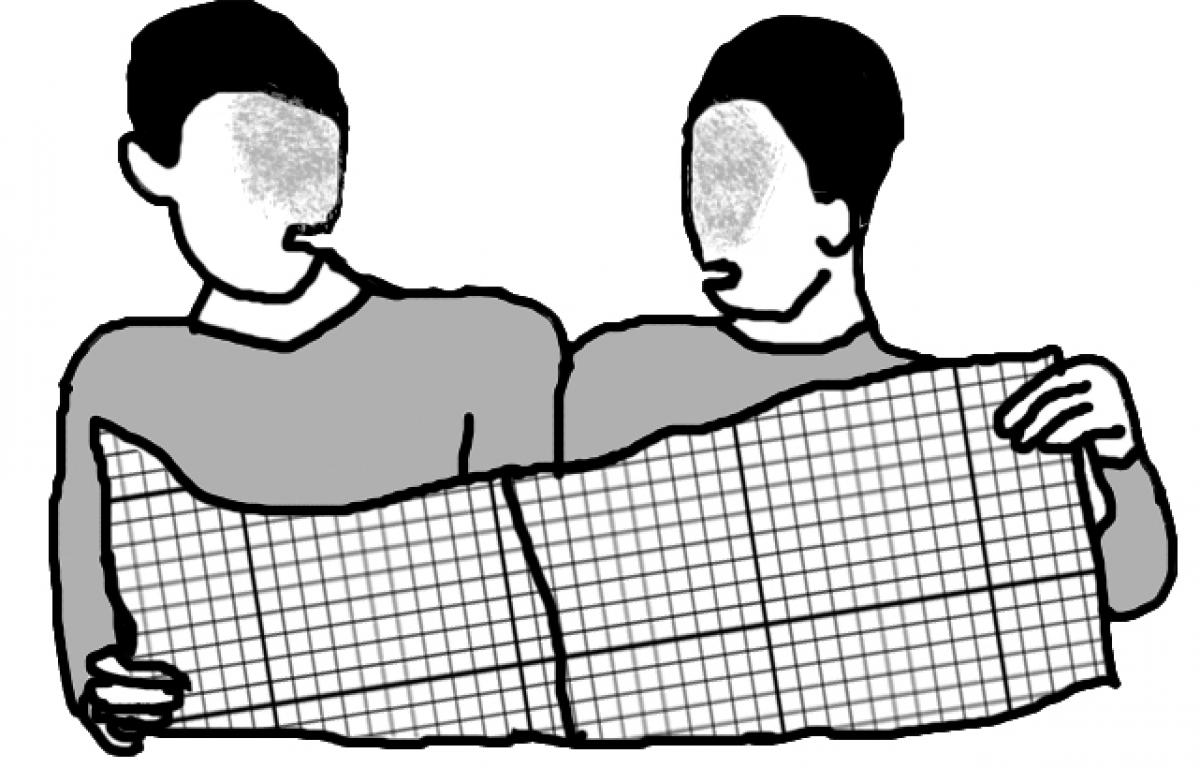
Begriffe wie Kolonialismus und Imperialismus bestimmen immer mehr die Debatten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine spricht selbst Bundeskanzler Olaf Scholz vom »russischen Imperialismus«, fordern Aktivisten, Russland zu dekolonisieren und reaktivieren Linke Begriffe aus der Zeit der Solidarität mit nationalen Befreiungsbewegungen. Doch wie werden Begriffe wie Kolonialismus und Imperialismus dabei verwendet, und wie sinnvoll sind sie für das Verständnis heutiger Konflikte? Peter Korig (»Jungle World« 35/2023) befürchtet, es könne sich eine linke Romantisierung von Befreiungsbewegungen wiederholen.
*
Es ist nachvollziehbar, dass Peter Korig der bei Teilen der Linken beobachtbaren »Wiederbelebung und Neuausrichtung antiimperialistischer und antikolonialer Politik« in Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine mit kritischen Vorbehalten begegnet. Er kritisiert an diesem neuen, ukrainesolidarischen Antiimperialismus einen geschichtsvergessenen Blick auf Russland, unter dem »das zaristische Russland, die Sowjetunion und das heutige Russland nur Aggregatzustände eines überhistorischen russischen Kolonialismus und Imperialismus« darstellen. Seine Unterscheidung zwischen »kolonialen« und »postkolonialen« Gesellschaften ist aber etwas zu schematisch. Die Sowjetunion, die auf den spezifischen Bedingungen aufbauen musste, die das russische Zarenreich mit seinen kolonialen Eroberungen hinterlassen hatte, sei ein Versuch gewesen, »Sozialismus, nationale Befreiung und Modernisierung zu verbinden«. Daher weise die »Gewaltgeschichte der Sowjetunion eher Ähnlichkeiten mit anderen postkolonialen Modernisierungsregimen« als mit Kolonialregimen auf.
Das trifft jedoch so allenfalls für die Frühphase der Sowjetunion zu, als die Bolschewiki unter der Führung Wladimir Iljitsch Lenins dessen Imperialismustheorie und deren Forderung nach »nationaler Selbstbestimmung« in einen scharfen Bruch mit der kolonialen »großrussischen« Tradition übersetzten und die nichtrussischen Bevölkerungsgruppen für die postrevolutionäre Staatsbildung zu gewinnen versuchten. Diese Politik firmierte unter der Bezeichnung »Korenisazija« (deutsch: Einwurzelung).
»Tatsächlich förderte die Sowjetregierung in den zwanziger Jahren das nationale Bewusstsein der nicht-russischen Gruppen und schuf für diese institutionelle Formen, die denen eines Nationalstaates ähnlich waren«, schreibt dazu der Historiker Martin Schulze Wessel in seinem jüngst erschienenen Buch »Der Fluch des Imperiums«. Diese Politik stieß besonders in der Ukraine unter Lenins Nachfolger Josef Stalin schnell an ihre Grenzen. Es kam zu Konflikten zwischen »nationalkommunistischen« und zentralistisch auf Moskau orientierten Kräften innerhalb der Kommunistischen Partei der Ukraine, bei der auch wirtschaftspolitische Differenzen eine Rolle spielten. Einige ukrainische Ökonomen prangerten überproportionale Abgaben aus dem ukrainischen Sozialprodukt an die Union an, die der offiziellen antikolonialen Rhetorik widersprächen. Stalin verwarf Lenins Politik der nationalen Kulturförderung und kehrte zu Prinzipien imperialer Herrschaft zurück. Die Vertreter der Politik der »Einwurzelung« wurden nun der Förderung »konterrevolutionärer Elemente« bezichtigt und Opfer einer brutalen Säuberungswelle, die sich bald gegen die ganze ukrainische – und auch die polnische – Intelligenz richtete.
Eine klare Trennung zwischen imperial-kolonial und postkolonial in der Geschichte Russlands und der Sowjetunion ist also nicht möglich. Beide Formen sind auf widersprüchliche Weise ineinander verwoben. Erst recht gilt dies für das postsowjetische Russland mit seinen racketförmig organisierten Kapitalgruppen. Während der Regierungszeit von Präsident Boris Jelzin (1991–1999) kam es zu einer von Korruption geprägten privaten Aneignung vormals öffentlicher Güter durch eine »Oligarchen« genannte Klasse »politischer Kapitalisten« in staatlichen Ämtern. Diese hat Jelzins Nachfolger Wladimir Putin unter immer rücksichtsloserem Einsatz von Macht- und Gewaltmitteln zentralstaatlicher Kontrolle unterworfen. So argumentiert jedenfalls, grob verkürzt wiedergegeben, der russische Politologe Ilya Matveev und spricht mit Blick auf die internationalen Verflechtungen des russischen Kapitals vom »Paradoxon eines abhängigen, halbperipheren Landes, das dennoch imperialistisch ist«.
Die Gleichzeitigkeit von imperialistisch-kolonialistischen und postkolonialen Zügen prägt nicht nur Russland, sondern auch die Türkei.
Sein Aufsatz, der ein Beitrag zur Debatte mit dem marxistischen ukrainischen Soziologen Wolodymyr Ischtschenko über Kapital- und Klassenkonflikte in Russlands Ukraine-Krieg war, erschien dieses Jahr in einem Dossier des Alameda Institute unter dem Titel »The War in Ukraine and Russian Capital: From Military-Economic to Full Military Imperialism«. Während beide Autoren sich weitgehend einig in der Analyse der Klasse »politischer Kapitalisten« und der Charakterisierung von Putins Herrschaft als Bonapartismus sind, besteht hinsichtlich der Kriegsgründe Dissens: Während Ischtschenko diese klassenanalytisch aus einem Konflikt zwischen den postsowjetischen »politischen Kapitalisten« einerseits und aufstrebenden, im Bündnis mit einer westlichen Antikorruptionspolitik verpflichteten NGOs sowie transnational agierenden Kapitalisten aus den professionellen Mittelschichten andererseits abzuleiten versucht, bestreitet Matveev, dass sich Putins Krieg so erklären lässt. Seiner Meinung nach markiert dieser einen »scharfen Bruch zwischen der ökonomischen und der politischen Logik des russischen Imperialismus«. Die seit der Annexion der Krim 2014 eskalierenden Kosten von Krieg und Sanktionen »untergruben die Position des russischen Kapitals erheblich«, daher könnten nur außerökonomische Motive wie tiefsitzende antiwestliche Paranoia und imperiale Mythen die Handlungsweise Putins und des ihn stützenden Sicherheits- und Staatsapparates erklären.
Die Gleichzeitigkeit von imperialistisch-kolonialistischen und postkolonialen Zügen prägt nicht nur Russland, sondern auch die Türkei. Beide Länder waren jahrhundertelang Imperien, gerieten aber im Zuge der von Westeuropa ausgehenden kapitalistischen Modernisierung und Durchdringung im 19. Jahrhundert zunehmend ins Hintertreffen gegenüber den anderen imperialistischen Mächten.
Beide Staaten konnten sich nur durch revolutionäre Umbrüche in die kapitalistische Moderne retten. In beiden Ländern wird der Verlust der alten imperialen Größe als narzisstische Kränkung empfunden, die eine Art postimperialen Phantomschmerz hinterließ, der sich unter den gegenwärtigen Bedingungen autokratisch-autoritärer Herrschaft in aggressiver Außenpolitik mit Rückgriffen auf alte Machtansprüche und Einflusssphären äußert – bei Erdoğan als Politik des »Neoosmanismus«, bei Putin in Form imperialer Geschichtsmythen, mit denen er den Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt.
Beide greifen bei ihren außenpolitischen Aspirationen aber auch auf eine antikoloniale Rhetorik zurück, um an antiwestliche Ressentiments zu appellieren. In seinen Reden an die Nation geißelt Putin Lenins antikoloniale Nationalitätenpolitik für die »künstliche Schaffung« einer ukrainischen Nation, während er sich gleichzeitig dem »Globalen Süden« als Vertreter dekolonialer nationaler Befreiung vom westlichen Joch präsentiert.
Korig macht den Aufstieg postkolonialer Theorien im akademischen Betrieb als einen der Gründe für die Wiederbelebung eines linken Antiimperialismus im Gefolge des Ukraine-Kriegs aus. In der Tat ist seit längerem vor allem unter Kultur- und Sozialwissenschaftler:innen der osteuropäischen und postsowjetischen Diaspora an westlichen Universitäten eine Hinwendung zu postkolonialen Theorieangeboten zu beobachten. Korig meint, dass dieser neue Antiimperialismus sich die Dekolonisierung Russlands »nur mehr als nationale Emanzipation« aller nichtrussischen Gruppen vorstellen könne, was wohl in der Tat auf ethnonationale Kleinstaaterei mit dem vielfachen Gewaltpotential der postjugoslawischen Zerfallskriege hinauslaufen würde. Doch dieses Urteil ist zu pauschal. Ein »Nothing about us without us« betitelter »offener Brief von Russlands indigenen und dekolonialen Aktivist:innen« etwa enthält eher eine Mischung aus bürgerrechtlichen Partizipations- und identitätspolitischen Forderungen aus dem Bereich der Critical Whiteness als einen Aufruf zum irredentistischen Aufstand der Indigenen in Russland.
Auch Ischtschenko kritisierte Ende vergangenen Jahres in der New Left Review, dass die Verbreitung des postkolonialistischen Paradigmas zu einer kulturalistischen und essentialistischen Identitätspolitik geführt habe, die das Ukrainische vor allem über den Gegensatz zu allem Russischen definiere und sich zudem bestens mit der gegen soziale und gewerkschaftliche Rechte gerichteten neoliberalen Politik von Wolodymyr Selenskyjs Regierung vertrage. Er fordert daher die Rückkehr zu einer universalistischen Perspektive.
Es stellt sich aber die Frage, ob in den linken Debatten über den Ukraine-Krieg hierzulande das größere Problem nicht in der ignoranten Haltung zum unumgänglichen militärischen Abwehrkampf gegen den russischen Angriff zu sehen ist. Dies betrifft nicht nur in ihrem Antiamerikanismus geeinte antiimperialistische Spätstalinisten und Friedensbewegte, sondern auch antinationalistische postautonome Gruppen, wie ein Beitrag der Gruppe Interventionistische Linke (IL) in Analyse & Kritik bezeugt.
Nachdem zunächst treuherzig Verständnis für den Wunsch linker Ukrainer:innen bekundet wird, »nicht in einer russischen Besatzungszone (zu) leben oder gar Teil von Neurussland« zu werden, folgen Belehrungen, dass ukrainische Linke sich durch ihre Beteiligung am »Selbstverteidigungskampf der ukrainischen Nation« als Teil eben dieser konstituieren und dadurch »den Klassenkampf in der Form der Nation auf(heben)«, wodurch sie sich selbst die »Perspektiven der linken Opposition und gar Emanzipation« langfristig verbauen würden. Überhaupt sei Neutralität und »Verweigerung des Lagerdenkens« für Linke geboten – erst recht für deutsche Linke. Die weiteren Empfehlungen könnten ebenso gut von Sahra Wagenknecht kommen. Solch empathiebefreiter Paternalismus gegenüber ukrainischen Linken, die gegen Russlands Invasion kämpfen, lässt sich als ein von kolonialem Blick geprägtes »Westsplaining« kritisieren.