Genozid an den Jesiden: 'Verbrechen einen Namen geben'

Jesidische Flüchtlinge im September 2014, Bild: Thomas von der Osten-Sacken
Seit einiger Zeit schieben verschiedene Bundesländer Jesidinnen und Jesiden in den Irak ab. Und das, nachdem Anfang des Jahres der Bundestag die Verbrechen des Islamischen Stadt an den Jesiden als Völkermord anerkannt hat.
Über dieses Thema habe ich das Editorial des Winter-Rundbriefes von Wadi verfasst, das ich in Auszügen hier teile:
Im Sommer nächsten Jahres wird sich zum zehnten Mal der Jahrestag der unbeschreiblichen Massaker jähren, die 2014 vom Islamischen Staat an den Jesidinnen und Jesiden im Irak begangen wurden. Diese Verbrechen wurden inzwischen auch, und das einstimmig, vom deutschen Bundestag als Genozid oder Völkermord eingestuft. Eine Entscheidung, die ganz sicher auch im Sinne von Raphael Lemkin gewesen wäre, jenem Mann, der es fast im Alleingang in den vierziger Jahren schaffte, dass die damals noch jungen Vereinten Nationen die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ verabschiedeten. Der polnisch-jüdische Jurist Lemkin, der vor den Nazis in die USA geflohen war, hörte dort regelmäßig die berühmten Radioansprachen des britischen Premier Winston Churchill. In einer bezeichnete dieser das „barbarische Wüten der Nazis“ als „ein Verbrechen ohne Namen.“ Lemkin wollte diesem Verbrechen nicht nur einen Namen geben, nämlich Genozid, sondern auch dafür sorgen, dass niemals Ähnliches wieder geschehe.
Entsprechend ambitioniert war dann auch die Konvention der UN, der es weniger darum ging, im Nachhinein Verbrechen als Genozide anzuerkennen, sondern vielmehr verbindlich dafür zu sorgen, dass das so oft bemühte „Nie Wieder“ in international gültiges Recht überführt werde und man all jenen, die im Verdacht stehen, einen Genozid zu planen, präventiv in den Arm fallen könne, denn, wie Lemkin auf einer Rede einmal feststellte, Genozid sei sogar noch schlimmer als Krieg.
Geschichte so geht weiter
Bekanntermaßen ging Geschichte seitdem so weiter, wie Walter Benjamins Engel der Geschichte sie seit je erlebte, nämlich als „Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert“. Ob in Kambodscha, Ruanda oder im irakischen Sinjar-Gebirge, vor aller Augen fanden erneut Genozide statt, ohne dass irgendwer den Mördern in den Arm gefallen wäre. Stattdessen gab es nach jedem dieser Menschheitsverbrechen lediglich irgendwelche Schwüre, dass Ähnliches nie wieder geschehen dürfe. Die hielten dann jeweils genau bis zum nächsten Mal.

Von einer Jesidin gemaltes Bild über den Horror, den sie erleben musste
Den Genozid unterscheidet von anderen Massakern, Kriegen und Verbrechen auch, dass die Völkermörder, egal, was später mit ihnen auch geschehen mag, immer als Sieger dastehen. Diese Tatsache ist so furchtbar, dass man sie in der Regel abwehrt und verdrängt, und doch gehört sie immer wieder ausgesprochen. So ist es auch mit den Jesidinnen und Jesiden im Irak: Der Islamische Staat hat zwar sein Ziel nicht erreicht, sie sind nicht vollends vernichtet oder zerstört, aber einen status quo ante wird es für sie nicht mehr geben. Hunderttausende leben inzwischen in Europa und anderen westlichen Ländern, die meisten allerdings noch immer in so genannten Lagern für Binnenvertriebene im kurdischen Nordirak. Eine Hoffnung auf Rückkehr in das Sinjar-Gebirge gibt es für sie kaum, denn dort haben noch immer diverse Milizen das Sagen, und große Teile des Gebietes liegen weiter in Trümmern.
In Lagern geboren und aufgewachsen
Man macht es sich kaum klar, aber in den Camp-Schulen, in denen unsere jesidischen Mitarbeiterinnen im Rahmen der Anti-Gewalt-Kampagne von WADI arbeiten, sind inzwischen alle Grundschülerinnen und -schüler in den Lagern geboren. Sie kennen keine andere Realität mehr. Und wenn sich nichts Grundlegendes ändert, wovon momentan leider auszugehen ist, dann dürften sie auch ihren Schulabschluss als Internal Displaced Persons (IDP, wie Binnenvertriebene im Jargon der UN heißen) in diesen Camp-Schulen machen. IDP ist nebenbei eine Wortschöpfung aus den Zeiten, als die UN-Konvention verabschiedet wurde und bezeichnete eben Abermillionen von Menschen, die in Folge des „barbarischen Wüten der Nazis“ heimatlos geworden waren und nun durch Europa irrten.

Schule im Khanke Camp bei Dohuk
Das Schicksal dieser Schülerinnen und Schüler ist nur ein Beispiel unter vielen, was es heißt, Opfer eines Genozids zu sein. Zu erinnern sei auch an alle, die als so genannte Sexsklavinnen von IS-Kämpfern missbraucht wurden und an die, deren Familienangehörige in einem der unzähligen Massengräber in den letzten Jahren exhumiert wurden.
Es hätte verhindert werden müssen
So wichtig es ist, dass das, was ihnen geschehen ist, nun vom deutschen und von anderen Parlamenten als Genozid anerkannt wird, so viel wichtiger wäre es 2014 gewesen, als sich so klar abzeichnete, was geschehen würde, die Tat mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. Denn diese Tragödie hätte verhindert werden können, wäre da nur der Wille gewesen, die Konvention zur Verhütung von Genoziden umzusetzen. So bleibt nur als Trost, dass jene, die in Europa gefasst und angeklagt werden, mit hohen Strafen rechnen müssen. Rechtsprechung, wie sie zum Glück nun immer wieder gegen sie stattfindet, ist aber keine Widergutmachung, denn niemals kann auch nur in Ansätzen wieder gutgemacht werden, was damals vernichtet wurde.
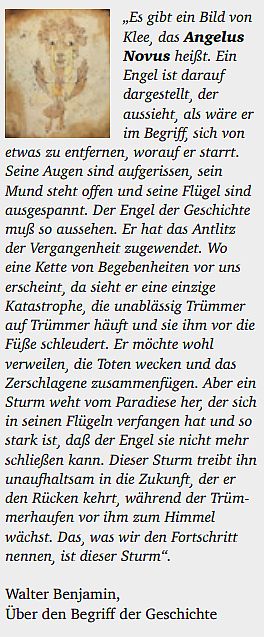 Umso wichtiger wäre es, den Überlebenden mit allen Mitteln zur Seite zu stehen, ihnen genau dabei im wahrsten Sinne zu helfen: Beim Überleben, und wo immer möglich auch ein neues Leben zu beginnen. Dies ist nicht nur Gebot von Humanität, sondern auch das stärkste Zeichen, das man gemeinsam an die Täter senden kann: Ihr habt zwar gesiegt und doch auch nicht gesiegt, denn es ist Euch nicht gelungen, diese Gruppe, die Ihr vernichten wolltet, zu vernichten.
Umso wichtiger wäre es, den Überlebenden mit allen Mitteln zur Seite zu stehen, ihnen genau dabei im wahrsten Sinne zu helfen: Beim Überleben, und wo immer möglich auch ein neues Leben zu beginnen. Dies ist nicht nur Gebot von Humanität, sondern auch das stärkste Zeichen, das man gemeinsam an die Täter senden kann: Ihr habt zwar gesiegt und doch auch nicht gesiegt, denn es ist Euch nicht gelungen, diese Gruppe, die Ihr vernichten wolltet, zu vernichten.
Jedes Mädchen, das aus den Fängen des IS zurückkehrte und wieder aufgenommen wurde, das nun vielleicht, und solche Beispiele gibt es viele, studiert, einen Friseursalon eröffnet oder anderen hilft, ist ein Sieg über jene, die es zerstören wollten. Allein unsere Partnerorganisation in Dohuk, das Jinda-Zentrum, hat Hunderten von Mädchen bei der Reintegration geholfen, zuletzt in dem inzwischen erfolgreich arbeitenden Recycling-Center im Khabatoo-Camp, ebenso wie andere Organisationen dies bei Hunderten anderen Mädchen taten.
In Vergessenheit geraten
Solche kleinen Erfolgsgeschichten sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Schicksal der Jesiden langsam aber sicher international in Vergessenheit gerät. Andere Katastrophen häufen unablässig Trümmer auf Trümmer und beherrschen die Schlagzeilen und oft werden wir fast erstaunt gefragt: Was, noch immer leben Hunderttausende von ihnen in Camps? Ja, tun sie, und dass dies in Vergessenheit gerät, ist leider als ein weiterer und später Sieg derer zu bezeichnen, die sie damals auslöschen wollten.
Abschiebebescheide
Ebenso erschreckend ist, was dieser Tage hierzulande passiert: Zunehmend erhalten Jesidinnen und Jesiden, die es damals nach Deutschland als Flüchtlinge geschafft hatten und nur nach § 51 oder § 53 des Ausländerrechts geduldet wurden, Abschiebebescheide. Die ersten wurden sogar schon gegen ihren Willen in den Irak „ausgeschafft“, wie es in der kalten Amtssprache heißt. Mit wachsendem Entsetzen verfolgen Zehntausende, die ebenfalls von solchen Bescheiden betroffen sein könnten, diese Entwicklung, und jesidische Organisationen schlugen Alarm, einige organisierten sogar in Berlin einen Hungerstreik.
Auch wir trauten erst nicht unseren Augen bzw. Ohren, als wir von diesen Entscheidungen erfuhren, und wurden dann zusammen mit anderen Organisationen und Einzelpersonen aktiv. Gemeinsam verfassten wir einen offenen Brief an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags, um sie daran zu erinnern, dass sie noch vor wenigen Monaten die Verbrechen des IS als Genozid anerkannt hatten.

„Nie wieder“?
Wir hoffen, dass dieser, von vielen namhaften Erstunterzeichnern unterstützte Brief, Wirkung zeigt und werden sonst auch weiter alles versuchen, um weitere Abschiebungen zu verhindern.
Der Brief schließt mit folgenden Worten: „Zeigen wir alle gemeinsam, dass Deutschland nicht mehr das Land ist, für den der juristische Begriff des Völkermordes gefunden wurde, sondern ein Land, das an der Seite der Schwachen und Schutzbedürftigen steht.“
Das ist das Mindeste, was zu erwarten oder zu erhoffen wäre. Schließlich ist es sonst mit dem „Nie Wieder“ nicht weit her. Dieser Tage häufen sich erneut Warnungen, dass im Sudan, wo seit Monaten ein blutiger Bürgerkrieg herrscht, vor dem bis jetzt alleine sieben Millionen Menschen geflohen sind, erneut ein Genozid drohen könnte, nämlich in der Region Darfur – durchgeführt von den Nachfolgern jener berüchtigten Janjaweed-Milizen, die dort schon einmal solche Massaker und Verbrechen an Zivilisten verübt haben, die den Internationalen Strafgerichtshof veranlassten, eine Anklage wegen mutmaßlichem Völkermord zu erheben.