Es geht nicht um Inhalte
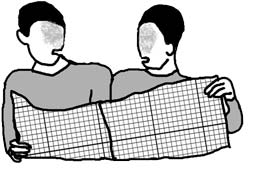 Der »Letter on Justice and Open Debate« im US-amerikanischen »Harper’s Magazine« hat Widerspruch ausgelöst. Tom Uhlig forderte (Jungle World 30/2020), über die Inhalte der jeweiligen Kritik zu sprechen, nicht über die Form.
Der »Letter on Justice and Open Debate« im US-amerikanischen »Harper’s Magazine« hat Widerspruch ausgelöst. Tom Uhlig forderte (Jungle World 30/2020), über die Inhalte der jeweiligen Kritik zu sprechen, nicht über die Form.
Es ist schon unangenehm: 153 prominente Intellektuelle, viele davon richtig schlau und manche sogar eindeutig links, beklagen eine »Intoleranz gegenüber Andersdenkenden« im linksliberalen Milieu. Was soll man dazu sagen, wenn man für linksliberale Medien schreibt, also irgendwie gemeint sein könnte? Am besten, man tut so, als habe man gar nicht verstanden, worum es geht. So machten es etliche deutsche Feuilletonistinnen in Reaktion auf den »Letter on Justice and Open Debate«, der Anfang Juli im US-amerikanischen Harper’s Magazine erschien. Auch Tom Uhlig wirft den Unterzeichnenden vor: »Statt Beispiele zu bringen und konkrete Probleme zu benennen, werden lediglich Andeutungen gemacht.«
Darum muss man wohl erst mal erklären, worum es den Verfassern geht und worum nicht. Es stimmt, die erhobenen Vorwürfe sind allgemein gehalten. Das ist meistens so bei Aufrufen, die viele unterschreiben sollen. In dem Brief heißt es: »Allzu oft werden heute als Reaktion auf vermeintliche sprachliche oder gedankliche Entgleisungen schnelle und harte Vergeltungsmaßnahmen gefordert«, und weiter: »Redakteure werden entlassen, weil sie umstrittene Beiträge gebracht haben«; »Journalisten wird verwehrt, über bestimmte Themen zu schreiben«; »gegen Professorinnen wird ermittelt, weil sie im Unterricht gewisse literarische Werke zitiert haben«.
So etwas kann vorkommen, ohne dass es bedenklich wäre. In jeder Kultur gibt es Grenzen des Sagbaren. Vor 200 Jahren durfte man nicht schreiben, dass Gott nicht existiert. Heute kriegt man Ärger, wenn man behauptet, Frauen seien dümmer als Männer – selbst in Saudi-Arabien ist das inzwischen so (Jungle World 42/2017). Das ist eine positive Entwicklung. Es ist nichts daran auszusetzen, wenn Menschen, die sich eindeutig rassistisch, sexistisch, antisemitisch oder LGBT*QI-feindlich äußern, Widerspruch erfahren.
Doch hinter der allgemein gehaltenen Aufzählung in dem Brief stehen konkrete Fälle, die einige der Unterzeichner an anderer Stelle eingehend beschrieben haben, beispielsweise der Politikwissenschaftler Yascha Mounk in einem Artikel in The Atlantic. Jeder, der sich mit den US-amerikanischen Debatten der vergangenen Jahre beschäftigt hat, kennt etliche Berichte über weitere Fälle von Menschen, die willkürlich an den Pranger gestellt wurden. Einigen wurde deswegen gekündigt, ohne dass die Vorwürfe geprüft worden wären. Oft kann man die Vorwürfe gar nicht verstehen, wenn man nicht mit den aktuellen Debatten an den Universitäten vertraut ist. Häufig sind die Fälle uneindeutig. Schon ein Like bei einem falschen Tweet oder das Teilen einer Studie, die als transfeindlich empfunden wird, kann zu einem Sturm der Entrüstung führen. Die Kritiker fordern oft ausdrücklich, dass die kritisierte Person ihren Arbeitsplatz verlieren oder keine Aufträge mehr bekommen soll – und das geschieht dann oft auch.
Die Unkultur des willkürlichen Anprangerns zeichnet aus, dass die Angreiferinnen für sich in Anspruch nehmen, nicht diskutieren zu müssen.
Wenn diese konkreten Fälle stattgefunden haben wie beschrieben, ist das erschreckend – nicht zuletzt weil es zeigt, wie schlecht Arbeitnehmer in den USA vor willkürlichen Kündigungen geschützt sind. Auch weil der Arbeitnehmerschutz in Europa deutlich besser ist, gibt es das in dem Brief benannte Problem hierzulande nicht in derselben Form. Hier muss jemand schon gegen alle guten Sitten verstoßen, um tatsächlich »gecancelt« zu werden. Die Bücher des veganen Kochs Attila Hildmann wurden erst aus Buchhandlungen geräumt, als gegen diesen schon der Staatsschutz wegen Volksverhetzung ermittelte.
Trotzdem trifft der offene Brief auch hier. Denn willkürliches Anprangern gibt es durchaus – es vergiftet auch hier die Atmosphäre und schadet den wichtigen Anliegen, die die Angreiferinnen vorgeben zu haben: gegen Rassismus, Sexismus und LGBT*QI-Feindlichkeit einzutreten. Dabei darf man nicht alles in einen Topf werfen, wie es viele Kritiker des offenen Briefes tun. Jemanden anzuprangern, kann völlig berechtigt sein. Zwischen willkürlichem und gerechtfertigtem Anprangern lässt sich jedoch leicht unterscheiden: Gerechtfertigt ist es dann, wenn die Vorwürfe belegt und so erläutert werden, dass sie von den meisten wohlmeinenden Menschen verstanden werden können. Das ist gelungen beim Nachweis des Antisemitismus der BDS-Bewegung, die zum Boykott von Waren und Künstlern aus Israel aufruft. Diese Argumente haben dann sogar sämtliche Parteien im Bundestag verstanden.
Oft werden aber Vorwürfe erhoben, die weder belegt noch erklärt werden. Zuhörerinnen halten bei einem Vortrag Schilder hoch, auf denen »Häh?« steht, weigern sich aber, der Referentin den Grund dafür zu erklären. Auch ich habe erlebt, dass Studentinnen bei einem Vortrag konstatierten: »Wir finden das rassistisch, was du erzählst.« Auf freundliche Nachfrage, was denn genau rassistisch sei, bekam ich keine Antwort – nicht einmal als ich selbst mögliche kritische Punkte nannte, um die Kritikerinnen zu motivieren. Sie fanden das offensichtlich eindeutig. Das war es aber nicht – und ist es oft nicht. Denn viele Interventionen und Shitstorms richten sich gegen Personen, die genau wie ihre Kritiker gegen Rassismus, Sexismus, LGBT*QI-Feindlichkeit eintreten. Diese Unkultur des willkürlichen Anprangerns zeichnet aus, dass die Angreiferinnen für sich in Anspruch nehmen, nicht diskutieren zu müssen. Sie behaupten einfach und verkünden Dogmen, die die Angegriffenen oft nicht kennen. Zuweilen werfen sie auch nur mit Schlamm.
Tom Uhlig kritisiert deshalb die falsche Seite, wenn er urteilt: »Die nicht liberale, sondern liberalistische Position der Unterzeichnenden fetischisiert die Methode und ignoriert den Inhalt.« Das Problem ist gerade die Methode, nicht der Inhalt. Über den Inhalt kann man nämlich nicht diskutieren, solange er nicht offengelegt wird. Dieses Verfahren, das allein dazu dient, andere mundtot zu machen, hat längst jene subkulturellen Nischen verlassen, in denen Eingeweihte sich Dogmen geben, deren Einhaltung sie dann mit einer gewissen Berechtigung fordern. Das ist okay, wenn man die Sekte verlassen kann.
In den sozialen Medien werden schnell Etikette wie rassistisch oder transfeindlich vergeben, ohne Erklärung oder klaren Beleg. Inzwischen passiert das sogar in den alten Medien. Nehmen wir beispielsweise den Verriss des offenen Briefs in der Taz. Darin will die Autorin Carolina Schwarz unter anderem zeigen, dass viele Unterzeichnende ihre Shitstorms verdient haben. Ein Beispiel dafür ist die mittlerweile ehemalige Meinungsredakteurin der New York Times, Bari Weiss. Diese »meldete angeblich eine Schwarze Redakteurin bei ihrem Vorgesetzten, weil diese keinen Kaffee mit ihr trinken wollte – und wurde dafür öffentlich kritisiert«, schreibt Schwarz dazu. Weiss hat also eine unfreundliche Kollegin und ist eine Petze – angeblich. Sagt uns das irgendetwas Verurteilenswertes über Weiss? Der Artikel in der Taz verlinkt einen Twitter-Thread, der die Geschichte belegen soll. Hier wird Weiss für vieles beschimpft und kritisiert, jemand behauptet, sie habe seine Frau bei ihrem Arbeitgeber gemeldet wegen der verweigerten Verabredung. Die Geschichte ergibt wenig Sinn, außer man möchte suggerieren, dass Bari Weiss eine Rassistin ist, was das Attribut »schwarz« nahelegt. Das ist mit Schlamm werfen. Dabei gibt es jede Menge Kritik an Weiss, die eine deutsche Leserin nachvollziehen könnte. Oft wird ihr vorgeworfen, dass sie Zionistin ist. Dass die Taz diese Information weglässt, auch noch zwei Tage später, als sie eingehender über Weiss’ Kündigung bei der New York Times berichtet, sagt zwar politisch einiges aus, es ist im Meinungskampf aber durchaus legitim – man muss sich seine eigenen Argumente nicht kaputt machen. Aber man muss nachvollziehbare Argumente vorlegen. Die hätte es durchaus gegeben. Weiss hat auch einen Shitstorm geerntet, als sie Kritik an #MeToo äußerte.
Die Geringschätzung des guten Arguments wird deutlich, wenn Belege durch dubiose Andeutungen ersetzt werden. Oft wird sogar behauptet, es brauche keine Argumente, da die Sache klar sei. Diese Herangehensweise kennzeichnet auch religiöse Fanatiker und Stalinisten. Dem sollten wir uns entschieden entgegenstellen.





