Auslöschung des Unbehagens
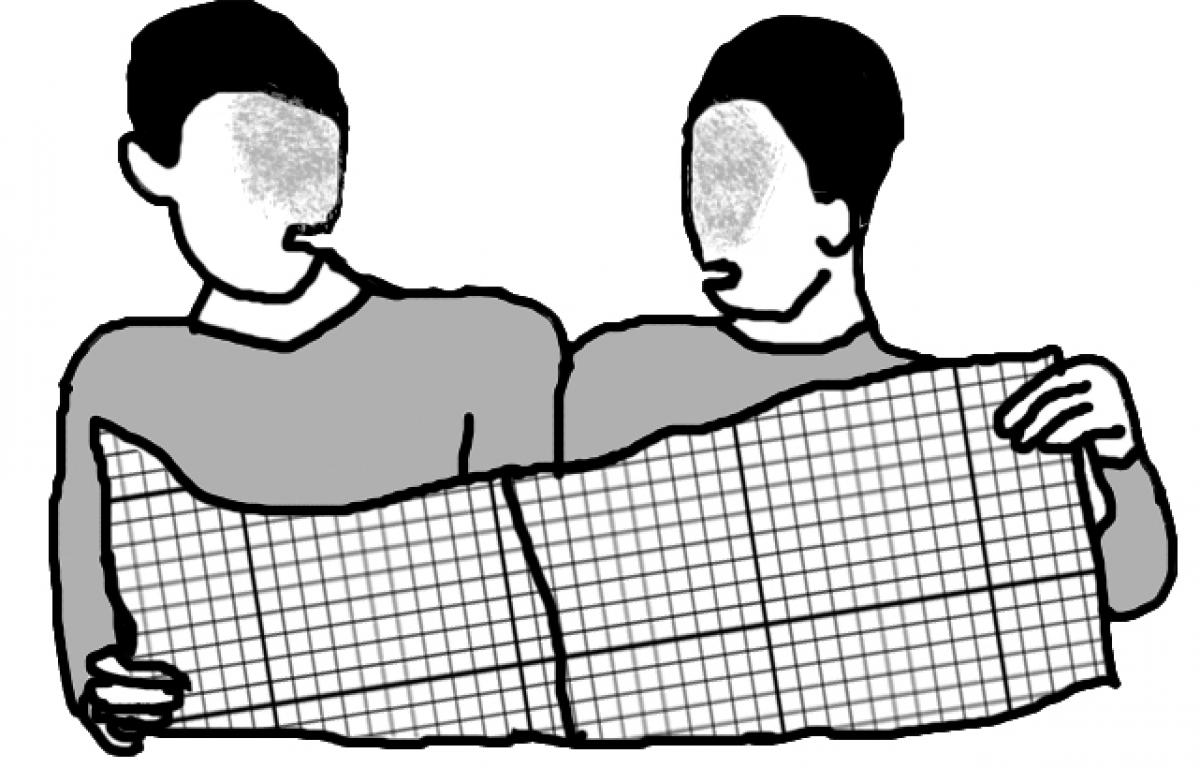 International machen Linke und Antirassisten die »German guilt« (deutsche Schuld) für eine vermeintliche Unterdrückung »propalästinensischer« Positionen in Deutschland verantwortlich. Doch auch außerhalb Deutschlands gibt es Linke, die für das Existenzrecht Israels einstehen und einen Schulterschluss mit Islamisten und Antisemiten ablehnen. Yves Coleman kritisierte, dass der Linken die Begriffe fehlen, um den politischen Islam zu analysieren (»Jungle World« 49/2023). Peshraw Mohammed analysiert diesen als faschistische Ideologie (51/2023). Susie Linfield beklagte eine Rückkehr linker Abscheulichkeiten (2/2024).
International machen Linke und Antirassisten die »German guilt« (deutsche Schuld) für eine vermeintliche Unterdrückung »propalästinensischer« Positionen in Deutschland verantwortlich. Doch auch außerhalb Deutschlands gibt es Linke, die für das Existenzrecht Israels einstehen und einen Schulterschluss mit Islamisten und Antisemiten ablehnen. Yves Coleman kritisierte, dass der Linken die Begriffe fehlen, um den politischen Islam zu analysieren (»Jungle World« 49/2023). Peshraw Mohammed analysiert diesen als faschistische Ideologie (51/2023). Susie Linfield beklagte eine Rückkehr linker Abscheulichkeiten (2/2024).
*
Der ursprüngliche Rassismus rührt von einer instinktiven Distanz her: Ich mag die nicht, die nicht so sind wie ich, bis man entdeckt, dass sie als Teil der menschlichen Spezies so sind wie man selbst. Im habsburgischen Spanien musste man, um als echter spanischer Hidalgo geadelt zu werden, beweisen, dass man kein Jude war. Reinheit des Blutes nannte sich das. Es gab jedoch keinen anderen Beweis als den Taufglauben, denn es bestand kein physischer, »rassischer« oder gar kultureller Unterschied zu sephardischen Konvertiten. Ein konvertierter Jude konnte dem katholischen Glauben mit gleicher Inbrunst anhängen wie jeder andere. Das Misstrauen gegen die conversos (Konvertiten) – für sie bestand die einzige Möglichkeit, der Deportation zu entgehen, darin, zum christlichen Glauben überzutreten – übersetzte sich in einen Rassismus, der aus dem Judentum eine unveränderliche, vererbbare Eigenschaft machte.
Antisemitismus ist also nicht nur der Hass auf denjenigen, der anders ist als man selbst, sondern auch auf denjenigen, der derselbe ist wie man selbst, aber anders ist, ohne dass es ihm bewusst wäre. Der Hass auf etwas, das man selbst sein könnte, muss beweisen, es nicht zu sein: Jude, verdammte Juden, Väter und Söhne des Kolonialismus, Väter und Söhne des Kapitalismus, Väter und Söhne des Rassismus, dessen Opfer sie sogar selbst sind. Opfer des ewigen Verbrechens: Sie tragen den unsichtbaren, aber grundlegenden Unterschied, so glaubte man, in ihrem Blut, nicht auf ihrer Haut.
Das ist die schlechte Nachricht, die die Juden seit Jahrhunderten in die Welt hinaustragen: die schlechte Nachricht vom wesentlichen Unbehagen eines Stamms, der weder seinen Gott den anderen Göttern des Pantheons noch seine Stämme den anderen Stämmen des Reichs hinzufügen wollte und seither ein Problem darstellt, das jede Pax Romana, die man errichten möchte, in Frage stellt. Bevor die Juden also die fünfte Kolonne der Welt waren, wurde dieses Volk ohne Armee zum Ursprung aller Kriege erklärt und war gleichzeitig ein Mittel, um durch aufeinanderfolgende Pogrome die Spannungen dieser Kriege zu lindern und ihre Söldner zu unterhalten.
Wie können ein elender Schuhmacher aus dem Ghetto und ein Bankbesitzer im selben Konzentrationslager sterben?
Ob man es mag oder nicht, es gibt einen bestimmten »jüdischen Kopf«, der Fehler sieht, wo alles logisch erschien, und Logik, wo alles eine Reihe von Fehlern zu sein schien: Canetti, Bergson, Adorno, Einstein, Trotzki, Lévi-Strauss, Proust. Die Liste der jüdischen »Verkomplizierer« beginnt schon, bevor Spinoza aus der jüdischen Gemeinde in den Niederlanden ausgeschlossen wurde, weil er die Dinge auch für sie kompliziert machte. Ganz zu schweigen von Marx und Freud. Man könnte einwenden, dass Nietzsche oder Hegel oder Kant, die keine Juden waren, die Dinge auch nicht zu sehr vereinfacht haben. Das ist es, was Nietzsche betonen will, wenn er über die Juden spricht. Ihm geht es darum, deutlich zu machen, dass sein eigenes essentielles Unbehagen nicht mit dem der Juden zu verwechseln ist, ein Volk, das er wie kein anderes bewunderte. Eine Bewunderung, die manchmal dem Hass glich. Liebe und Hass werden im modernen Antisemitismus fast immer verwechselt, mit seiner ständigen Vision des Juden als allmächtigem und bösem Wesen, das die Welt retten könnte, es aber nicht tut.
Der Charakter dieser Differenz, die sich gerade als unsichtbar bleibende in Hass entlädt, der von den Moralphilosophen als radikaler Rassismus angesehen wurde, ist das Zentrale. Es ist das Symptom eines Unwohlseins in der Kultur, in der Hannah Arendt die Ursprünge des Totalitarismus sehen wollte, aber vielleicht zeigt es vor allem eine Veranlagung, dessen Regeln zu akzeptieren, denn die Hauptregel des Totalitarismus ist die immerwährende Möglichkeit, Menschen und Kollektive physisch zu eliminieren, die sich in fast keiner sichtbaren und manchmal unsichtbaren Weise von denen unterscheiden, die sie verfolgen. Dies ist die Magie der stalinistischen Säuberungen, bei denen das Jüdischsein vieler der Gesäuberten ein wichtiges Argument blieb.
Vielleicht ist es das, was uns die Bereitschaft erklärt, mit der Lehrer und Studenten an den Universitäten in der ganzen Welt mehr oder weniger radikale Formen des antizionistisch-antisemitischen Diskurses als wesentlichen Teil ihres Antirassismus akzeptiert haben, und wie es ihnen gelungen ist, die brutalen Terrorakte des 7. Oktober nicht nur zu übersehen oder in einen notwendigen Akt des Widerstands, sondern gar in den Anbruch einer neuen Welt zu verwandeln. In den Beginn eines neuen Pakts, der die Juden nicht per se ausschließt, sondern sie auffordert, auf jegliche Verbindung mit Israel zu verzichten. Mit anderen Worten, es wird eine Bekehrung gefordert, nicht religiös, sondern historisch, national, politisch, so radikal wie die, die in der Kirche des Transits von Toledo (gemeint ist die Synagoge El Tránsito in Toledo, die 1492 mit der Vertreibung der Juden in eine katholische Kirche umgewandelt wurde; Anm. d. Red.) von den Juden gefordert wurde, um nicht aus Spanien vertrieben zu werden.
Nach dem Holocaust, der von einem christlichen Volk inmitten des christlichen Abendlands angerichtet wurde, können die Anhänger des Nazareners sich nicht besser als irgendwelche Barbaren nennen. Man ist sogar noch schlimmer, weil ein Gott für sie gestorben ist und man sie mindestens sechs Millionen Mal getötet hat. Alle postkolonialen Studien gehen in irgendeiner Weise von diesem schlechten Gewissen aus: dass der weiße Mann nicht nur genauso kriminell ist wie der schwarze oder gelbe Mann, sondern viel mehr. So sehr, dass man meint, er sei der einzige Mörder, und dass, selbst wenn andere töten, es der weiße Westler ist, der für sie tötet.
Der antizionistische Antisemitismus unterscheidet sich vom klassischen Antisemitismus durch die Integration der Erfahrung der Shoah. Die Vorwürfe der »Leugnung« eines Völkermords oder der »Hassrede« entstammen dem Kampf gegen den Neonazismus. Allerdings richtet der Antizionismus diese Vorwürfe nun gegen die Juden oder jene Kategorie von Juden, die das Privileg, Opfer zu sein, verloren haben, nämlich die Zionisten.
Wie lässt sich der europäische Antisemitismus des 20. Jahrhunderts unter dem Gesichtspunkt der Intersektionalität erklären? Wie können ein elender Schuhmacher aus dem Ghetto und ein Bankbesitzer im selben Konzentrationslager sterben? Wie können die Juden zugleich Opfer und Schöpfer des Kapitalismus sein? Oder Opfer des Sozialismus, den sie ebenfalls mit geschaffen haben? Und wie soll man einen Krieg feiern, den die größten kolonialen und kapitalistischen Mächte der Welt zusammen mit einem der grausamsten totalitären Imperien der Geschichte zur Rettung der Menschheit gewonnen haben (gemeint ist der Zweite Weltkrieg, Anm. d. Red.)?
Antisemitismus unterscheidet nicht nach Hautfarbe, wirtschaftlichem Status oder gar Religion und widersetzt sich damit der Vorstellung, dass Rassismus dasselbe sein kann wie Klassismus, Kolonialismus, Fremdenfeindlichkeit oder kapitalistische Ausbeutung. Natürlich ist er all das, aber er ist etwas anderes, das keines dieser Dinge ist. Antisemitismus ist etwas anderes ist als der einfache Machtmissbrauch der Mächtigen.
Es ist kompliziert, wie alles, in das die »jüdischen Köpfe« verwickelt sind, es ist moralisch und ethisch kompliziert und genau das verabscheut der postmoderne Geist. Nicht aus Faulheit, wie man meinen könnte, sondern aus einem Instinkt für Reinheit, aus einem dringenden Bedürfnis nach Klarheit.
Der heutige Antisemitismus ist jedoch gegenüber dem klassischen Antisemitismus in einem Punkt im Vorteil: Das Opfervolk hat es geschafft, ein weiteres Opfervolk zu kreieren: die Palästinenser. Die Rolle des sühnenden Opfers erfüllen sie in stärkerem Maße. Sie wurden 75 Jahre ins Exil getrieben, gemartert und verachtet, nicht nur von den Israelis, sondern auch von allen arabischen Nachbarn, die sie als Vorwand und Druckmittel für alle möglichen Geschäfte und Verhandlungen benutzt haben. Die Palästinenser leiden und haben für die postkolonialen Studien den Vorteil, dass sie Hautfarbe, Geschichte und eine Religion teilen.
In dem Engagement der weltweiten Linken für die palästinensische Sache kommt seit den siebziger Jahren eine seltsame Umkehrung der Schuld zum Tragen. Schuldig für das, was ihre Väter den Juden im Zweiten Weltkrieg angetan hatten, sah eine neue Generation junger deutscher Linksradikaler (die Mitglieder der Baader-Meinhof-Bande und verwandter Gruppen) in der palästinensischen Sache eine Möglichkeit, die Sünden ihrer Vorfahren wiedergutzumachen. Sie griffen zu den Waffen, um die »neuen Juden« zu verteidigen: die Palästinenser. Bei dem Versuch, den Nazismus ihrer Väter zu negieren, überraschten deutsche Linksradikale sich selbst, indem sie 1976 die Passagiere eines nach Uganda entführten Flugzeugs fragten, ob sie Juden seien oder nicht; nur nichtjüdische Passagiere wurden freigelassen. Mit anderen Worten: Sie taten am Ende genau das, was ihre Eltern in den Konzentrationslagern taten.
In der Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) gab es noch das säkulare Moment. Der Marxismus, in verworrenen und erratischen Versionen, bildete immer noch eine gewisse gemeinsame Grundlage für europäische Linksradikale und in der PLO organisierte palästinensische Widerstandsbewegungen. Schließlich handelte es sich um einen nationalen Befreiungskrieg. Die Omnipotenz des konservativsten Islamismus in dieser Bewegung lässt eine solche Illusion nun nicht mehr zu. Die europäische Linke begeistert sich für ultrarechte, nach Vorherrschaft strebende Gruppen, die ihr auf ihrem eigenen Territorium Angst einjagen. Ihr manichäisches Bild vom Unterdrückten und Unterdrücker lässt sie nicht erkennen, dass es unter diesen Unterdrückten auch Unterdrücker gibt.
Die Gründe für die Liebe zu denjenigen, die ihre Verachtung für den Westen auf jede erdenkliche Weise unter Beweis gestellt haben – Bomben, Attentate, Gräueltaten –, lassen sich zusammenfassen in der Ablehnung des christlichen Machtverzichts, der Legende, dass ein Opfer ins Zentrum der Religion stellt, der Logik der anderen Wange und der Trennung zwischen Kaiser und Gott, die das Christentum kennzeichnet. Radikale Feministinnen, fanatische Anarchisten, die sich in keiner Weise mit dem iranischen Regime identifizieren können, arbeiten für dieses, weil sie in ihrer Verachtung für die christliche Moralordnung übereinstimmen.
Der Islam ist wohl die am wenigsten westliche der drei großen Religionen, aber auch die modernste. Er wird nicht als eine religiöse Möglichkeit geliebt, sondern als eine Überwindung des jüdisch-christlichen Bewusstseins, des Opfers und der Erlösung, der Vergebung der Sünden und des Kreuzes als Anfang und Ende von allem. Geliebt wird die Einfachheit in einer Reinheit, die verlorenging, bevor die »jüdischen Köpfe« kamen, um alles zu verkomplizieren.
Es ist also der »islamistische Kopf«, der die Komplikation vereinfacht, die die »jüdischen Köpfe« und die Christen hinterlassen haben; er ist es, der im Schicksal des palästinensischen Volks geliebt wird, um das wir alle zu Recht weinen, für das aber niemand etwas Konkretes tut, außer zu weinen. Tränen und Hilflosigkeit für die Palästinenser, die nicht in den Ghettos darauf warten, wie die Juden im Holocaust abgeschlachtet zu werden, sondern deren Widerstandsversuche, die von der Jugend des Westens gefördert und ermutigt werden, nur mit mehr Schmerz und Leid für sie selbst enden.
Für die Anführer des Widerstands ist das ein furchtbar lohnender Schmerz, der mit Menschenleben bezahlt wird, die nicht Opfer, sondern Märtyrer eines immerwährenden und endlosen Kampfes sind, der das Herzstück des Islam darstellt. Eine Religion des Kampfs gegen eine Religion der Kapitulation, das Christentum, und eine der Geduld, das Judentum.
Es ist kompliziert, wie alles, in das die »jüdischen Köpfe« verwickelt sind; genau das verabscheut der postmoderne Geist.
Der Rassismus, der instinktive Hass auf alles, was anders aussieht als man selbst, die Verachtung möglicher Unterschiede ist dadurch zu überwinden, dass man dahinter versteckte Ähnlichkeiten findet. Anders der Antirassismus, der als die perfekte Umkehrung des Rassismus gedacht ist, seine beste Form findet im instinktiven Hass auf das, was gleich aussieht wie man selbst, und in der instinktiven Wertschätzung dessen, was nicht gleich aussieht wie man selbst. Es wäre also der ultimative Beleg dafür, antirassistisch zu sein, wenn man weiß, jüdisch, westlich ist und aus der Mittel- oder Oberschicht stammt und die Juden Israels dafür hasst, dass sie all das sind, aber mit Maschinengewehren und Kampfflugzeugen.
In der Tat ist die Forderung, Palästinenser nicht zu töten, weil sie Menschen sind, die Grundlage eines jeden minimalen humanitären Prinzips. Die Forderung, sie nicht zu misshandeln, weil sie »diese Menschen« sind, »diese Menschen, die nicht so sind wie ich«, stellt aus universalistischer Sicht einen inakzeptablen Unterschied dar, der aus christlicher Sicht jedoch lobenswert ist. Aber das christliche Mitgefühl entspringt dem Gedanken, dass der andere, ohne aufzuhören, ein anderer zu sein, letztlich ein Teil von einem selbst ist.
In dem natürlichen Mitgefühl für Kinder, alte Menschen oder Frauen, die in Gaza bombardiert, ausgehungert und getötet werden, sind die Spuren dieses Mitgefühls leicht zu erkennen, aber in der Bewunderung für politische Bewegungen, die Frauenrechte, Demokratie oder religiöse Toleranz verweigern, und in der Verachtung für diejenigen, die unter diesen Übeln leiden, steckt etwas mehr als umgekehrter Rassismus. Nicht in der Hautfarbe oder der Sprache suchen wir das, was uns als Menschen, als Sterbliche, als Schwache, als Würdige ähnlich macht, sondern das, was diese Ähnlichkeit leugnet. Man bewundert nicht denjenigen, der anders aussieht, aber im Grunde genommen gleich ist, sondern denjenigen, der anders aussieht und anders fühlt, denkt, handelt als wir.
Der Terrorist ist nicht der Rächer irgendeines Unrechts, sondern der Unsterbliche, der seine rohe Gewalt zur Schau stellt, der mächtige Waffenmeister. Derjenige, der das Mitgefühl, das Mitleid verweigern kann, der ohne mit der Wimper zu zucken dem Flehen dessen zuhören kann, der nicht sterben will, der, mit einer Sturmhaube bedeckt, die Idee Levinas’, dass der Blick ins Antlitz des anderen hemmt, verleugnet und weder sein eigenes Gesicht noch das Gesicht seines Opfers sieht, das in eine ethnische Gruppe, eine Religion, eine soziologische Kategorie verwandelt wird, die getötet oder zumindest ausreichend erschreckt werden muss. Es ist das Doppelgesicht des Märtyrers und des Henkers, des Helden und des Schurken. In den Unterdrückten sehen wir die Macht, die physische, grundlegende Macht des gesichtslosen Mannes, der mit einem Maschinengewehr über Leben und Tod seiner Mitmenschen entscheidet.
Jede Gesellschaft, die für diese Faszination ethische, politische oder religiöse Rechtfertigungen findet, wird zwangsläufig Opfer ihrer Macht, das heißt ihres moralischen Drucks. Der beispiellose Erfolg der Anschläge vom 7. Oktober besteht nicht darin, ein Alibi für diese Faszination von Gewalt und Blut gefunden zu haben, sondern darin, sie zu einem kleinen Ereignis, einer Anekdote in einem längeren und komplizierteren Krieg gemacht zu haben. Die Henker vom 7. Oktober haben es nicht nur geschafft, Helden zu sein, sondern sich in der Anonymität des Widerstands auch anonym, unsichtbar und unantastbar, fast banal zu machen. Ihre beispiellose Tat ist nur eine Fußnote in einer unendlichen Geschichte des Grauens, von der wir nicht sicher sind, ob wir sie jemals wieder loswerden.
*
Rafael Gumucio ist ein chilenischer Schriftsteller, Journalist und Mitgründer der chilenischen Zeitung »The Clinic«. Mit seinem autobiographischen Roman »Transitkind« über das Exil während der Militärdiktatur in Chile erlangte er internationale Bekanntheit und wurde 2002 mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet. Er schreibt unter anderem für verschiedene chilenische Tageszeitungen, für die »New York Times« sowie die spanischen Tageszeitungen »ABC« und »El País«, für Letztere als Kolumnist.











