Es gibt keine Täter mehr
Fabian Wolff ist gerade in aller Munde: Der Publizist, der sein Jüdischsein gerne vor sich hertrug und als Autoritätsargument nutzte, ist in Wirklichkeit gar nicht jüdisch. Kritik an seinem Verhalten ist bitter nötig und wichtig, doch tendiert die Debatte gerade dazu, sich vor allem mit seinen persönlichen Verfehlungen zu beschäftigen. Das verstellt die politischen Dimensionen der Sache. Fälle von erfundenen jüdischen Familiengeschichten gibt es häufiger, als man zunächst vielleicht annehmen mag, und während die individuelle Disposition dabei natürlich eine Rolle spielt, sind solche Fälle zuallererst politisch.
Die Judaistin und Historikerin Barbara Steiner legte in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk dar, dass das Bedürfnis, sich als Jüdin oder Jude zu identifizieren, in Deutschland Tradition habe. Kurz nach Kriegsende seien es vor allem Täter:innen gewesen, die versuchten, sich in der Rolle von Jüdinnen und Juden aus der Verantwortung zu stehlen. Heutzutage habe es wohl eher mit dem »Suchen nach Aufmerksamkeit« zu tun.
Man spricht bei solchen Fällen auch vom Wilkomirski-Syndrom, benannt nach dem angeblichen Auschwitz-Überlebenden Binjamin Wilkomirski, dessen »Erinnerungen« unter dem Titel »Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948« 1995 im Suhrkamp-Verlag erschienen. Drei Jahre später stellte sich heraus, dass der Autor in Wirklichkeit Bruno Dössekker heißt, nicht jüdisch und unbehelligt in der Schweiz aufgewachsen war. Weitere bekannte Fälle der vergangenen Jahre sind die Bloggerin Marie Sophie Hingst und der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Pinneberg, Wolfgang Seibert.
Sich nur auf Empathie für Opfer zu verlassen, kann zur Entpolitisierung von Gewalttaten führen.
Diese Fälle sagen einiges darüber aus, was die deutsche Erinnerungspolitik aus der Shoah macht. Diese Erinnerungspolitik begünstigt ein Verhalten wie das Wolffs unter anderem dadurch, dass sie sich stark auf Empathie stützt. In den vergangenen Jahren tendierte die Museumspädagogik dazu, Geschichte vor allem über das Erzählen von Einzelschicksalen – im Fall der Shoah in der Regel solche von Opfern – zu vermitteln. Das hat gute didaktische Gründe, bringt aber auch Verkürzungen mit sich.
Mit dem Fokus auf die Opfer ist in Ausstellungen häufig ein emotionalerer Zugang verbunden, weil Mitgefühl geweckt wird. Das wird allzu oft gar als »Lernziel« von solchen Ausstellungen definiert. Wenn dabei aber nicht gleichzeitig gefragt wird, warum dieses Leid Menschen angetan wurde, welche Konsequenzen es hatte und was dagegen hätte getan werden können, führt Empathie zu nicht viel.
Sich nur auf Empathie für Opfer zu verlassen, kann zur Entpolitisierung von Gewalttaten führen. Man kann problemlos Empathie für Opfer empfinden, ohne sich mit den politischen oder ökonomischen Gründen für ihr Leid auseinanderzusetzen – und, vor allem im deutschen Kontext, ohne sich fragen zu müssen, was das mit einem selbst und der eigenen Familiengeschichte zu tun hat. So werden Gewalttaten austauschbar und die Täter:innen verschleiert.
»Wir mögen Opfer«, formulierte die Historikerin Esther Benbassa in ihrem Buch »La Souffrance comme identité« dieses Problem. Wir erinnern uns lieber an erfahrenes Leid als an angetanes – denn Letzteres wirft die Frage nach der Verantwortung und nach Gegenstrategien auf. Die Identifikation mit den Opfern stellt gerade in einer Täter:innengesellschaft wie der deutschen ein Problem dar, da sie sich gut zur moralischen Entlastung eignet. Damit einher geht die Gefahr der Übernahme von Erinnerung: Durch die Identifikation mit Opfern können sich Betrachter:innen die moralische Überlegenheit, die der Opferstatus auch bedeutet, sozusagen leihen, ohne mit dem tatsächlichen Leid konfrontiert zu sein.
Man identifiziert sich eben lieber mit der Widerstandskämpferin im Museum als mit dem eigenen Nazi-Opa. Fälle von erfundenen Opferbiographien sind die am weitesten gehende Ausprägung dieses Leihens – hier schließt sich der Kreis zu Fabian Wolff, der sich in seinen Essays nur zu gerne besagter moralischer Überlegenheit bediente, vor allem um immer wieder gegen Israel zu wettern.
Der Historiker Stefan Mächler betont in dem Band »Phantastische Gesellschaft: Gespräche über falsche und imaginierte Familiengeschichten zur NS-Verfolgung«, dass der Blick auf die Täter:innen in der Auseinandersetzung mit der Shoah eigentlich zentral sei: »Die Täter:innen hatten einen Handlungsspielraum. Sie konnten Täter:innen werden oder Mitläufer:innen oder Wegschauende oder Widerständige oder was auch immer. Deshalb ist die Analyse, warum sie zu Täter:innen wurden, lehrreich.«
Doch dieser Analyse geht man in Deutschland immer noch aus dem Weg. Sich eine jüdische Familiengeschichte zu erfinden, ist nur eine besonders krasse Form dieser Vermeidung. Die Entpolitisierung von Erinnerung und das Ausblenden deutscher Täterschaft beginnen nicht erst mit erfundenen Biographien. Zu bedenken ist zudem, dass die deutsche Öffentlichkeit diese dankbar angenommen hat. Geschichten wie jene von Fabian Wolff bedienen das Bedürfnis nach einem Erinnern, das nicht weh tut. Es ist ein Erinnern, das Täterschaft abspaltet, keine Konsequenzen fordert und damit Vergessen beängstigend nahekommt.


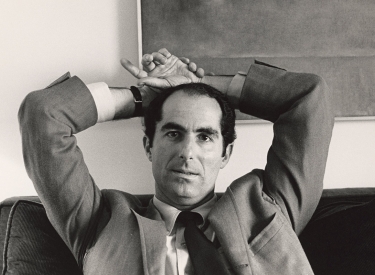
 Das Gewicht der unzähligen Ichs
Das Gewicht der unzähligen Ichs






