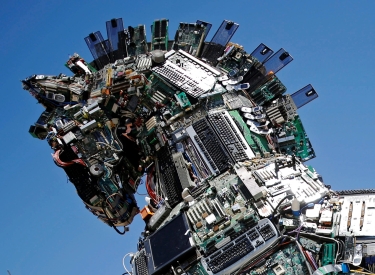»Die Frage, ob man zurückkehren soll oder nicht, ist kompliziert«
Sie sind Mitglied des Kibbuz Tzuba, der am westlichen Stadtrand von Jerusalem liegt, in den Jerusalemer Bergen. Er hat 700 Einwohner. Tzuba wurde 1948 gegründet und ist einer der wenigen Kibbuzim, die auf die Tradition des frühen 20. Jahrhunderts zurückgehen; manche nennen es ein sozialistisches Kibbuz-System. Was bedeutet das?
Ursprünglich waren alle Kibbuzim so strukturiert, dass es kein Privateigentum gab. Aber im Zuge der Finanzkrise in den späten siebziger und achtziger Jahren wurden die meisten von ihnen privatisiert. Bei uns dagegen gehen alle Gehälter immer noch direkt an den Kibbuz. Aber wir haben durchaus Privateigentum. Wenn ich Geld von meiner Oma erbe, kann ich es behalten. Es gibt auch einige kleine Privatisierungen, zum Beispiel bei Lebensmitteln. Ich kann nicht einfach in den Speisesaal gehen und so viel essen, wie ich will. Ich bezahle das Essen oder kaufe es im Supermarkt von dem Geld, das ich jeden Monat vom Kibbuz bekomme.
In den siebziger Jahren begann die politische Rechte, die Kibbuz-Bewegung stärker verbal anzugreifen. Sie warf ihr vor, eine von den aschkenasischen, europäischen Juden dominierte Kultur zu sein, zu der die aus dem Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika kommenden, sozial schlechter gestellten Mizrahim keinen Zugang hätten. Wie beurteilen Sie diese Vorwürfe?
In den frühen achtziger Jahren waren Vorwürfe gegen die Kibbuzim Teil des Wahlkampfs von Ministerpräsident Menachem Begin. Er zeichnete ein Bild von den Kibbuzniks als Millionäre, die sich am Pool sonnen und fernab von der Realität der hart arbeitenden, meist mizrahischen Bevölkerung in den umliegenden Gemeinden leben würden. Es gibt zwar einige Kibbuzim, die viel Land haben, auf der anderen Seite haben die Kibbuzim sich das aber auch über die Jahrzehnte selbst erarbeitet. Die Mitglieder wohnen nicht in großen Häusern. Die Lebensqualität ist gut, aber nicht glamourös.
Es ist leicht, über Kibbuzim Gerüchte zu verbreiten, weil sie als abgeschieden wahrgenommen werden. Dieser Eindruck wird sicherlich durch das gelbe Tor vor jedem Kibbuz verstärkt, das die Kibbuzim symbolisch von der Außenwelt trennt. In den ersten Jahren waren die meisten Kibbuzim tatsächlich überwiegend von Aschkenasim dominiert, mittlerweile sieht das anders aus. Man kann in den Kibbuzim, die vom Angriff der Hamas stark betroffen sind, anhand der Namenslisten der Opfer und Entführten erkennen, dass dort Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsbiographien leben.
Wird der Vorwurf, sich von der breiteren israelischen Bevölkerung zu isolieren, nicht durch das starke zivilgesellschaftliche Engagement der Kibbuzniks widerlegt?
Ja, es gibt zwischen den Kibbuzim große Solidarität, wir engagieren uns auch in anderen sozialen Zusammenhängen, in sozialen Projekten in den umliegenden Gemeinden. Wir waren auch bei den Protesten gegen die Justizreform sehr aktiv. Der Kibbuz übernahm die Kosten für die Fahrten zu den Demonstrationen in Tel Aviv und wir übernahmen die Verantwortung für eine kleine, aber ziemlich bekannte und lautstarke Demonstration am Autobahnkreuz auf dem Highway 1, der Hauptroute von Tel Aviv nach Jerusalem.
Die offizielle Position des Kibbuz bestand darin, die Protestbewegung zu unterstützen und sich gegen die derzeitige Regierung zu stellen. Es gibt zwar auch einige Mitglieder meines Kibbuz, die für diese Regierung gestimmt haben und die Justizreform unterstützen, aber wahrscheinlich nur eine Handvoll. Wir verstehen uns gut, solange wir nicht über Politik sprechen.
Die Kibbuzim im Süden waren die am stärksten vom Angriff der Hamas betroffenen Gemeinden. Sie haben viele Evakuierte aus diesen Kibbuzim aufgenommen und man weiß nicht, wann sie dorthin zurückkehren können. Womit ist Ihr Kibbuz seitdem konfrontiert?
Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Die Angriffe vom 7. Oktober haben die Notwendigkeit zur Selbstverteidigung gezeigt. Wir haben daher auch mehr Waffen für die Sicherheitskräfte gekauft, unsere Patrouillen und unsere Wachen verstärkt. Zudem sind viele Leute aus dem Kibbuz momentan in der Armee.
Und wir haben die Evakuierten, die im Hotel unseres Kibbuz wohnen. Wir versuchen, ihnen so gut wie möglich zu helfen. In den ersten Wochen kamen vor allem Menschen aus den Städten des Südens zu uns, nicht aus den Kibbuzim. Viele von ihnen waren orthodox oder ultraorthodox.
Seit zwei Monaten haben wir aber eine konstante Gruppe. Sie sind aus einem Moshav, einer genossenschaftlich organisierten Siedlung. Sie sollten eigentlich bis Ende des Monats abreisen. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Sie sind aber wirklich gut integriert. Ihre Kinder besuchen die örtlichen Schulen und den Kindergarten.
Sie können die Infrastruktur des Kibbuz nutzen?
Ja, aber sie wollen auch Autonomie. Sie betreiben einen eigenen Kindergarten, darum haben sie gebeten. Aber die Kinder im Schulalter gehen mit unseren Kindern in den Unterricht. Es ist sehr schwierig, mit der ganzen Familie in einem kleinen Raum zu leben. Unser Hotel ist schön, aber dort zu bleiben für längere Zeit mit einer vier-, fünf- oder sechsköpfigen Familie, ist nicht einfach.
Nicht die Regierung, sondern die Zivilgesellschaft hat die große Anzahl an Evakuierten unterstützt, die Kibbuzim spielten eine wichtige Rolle. Sehen die Menschen die Bewegung jetzt anders? Kann das sogar zu ihrer Wiederbelebung beitragen?
Zuerst waren wir völlig verlassen, jeder für sich. Es gab keine Regierung, kein Militär. Die Menschen wurden einfach dem Tod überlassen. Das war ein Schock. In einem solchen Moment ist es wirklich beruhigend, in einem Kibbuz zu leben, in einer funktionierenden Gemeinschaft. Hier haben wir am 7. Oktober sofort angefangen, die Verantwortlichkeiten aufzuteilen. In derselben Nacht stellten wir Patrouillen auf, öffneten die Schutzräume und organisierten die Logistik. Man spürte, dass man etwas tun kann, nicht nur zu Hause sitzt, auf Sirenenalarm wartet und dann in den Schutzraum rennt.
»Der Zweck der Kibbuzim war es immer, als Vorposten, als Sicherheitspuffer für die israelische Gesellschaft zu dienen. Das hat sich geändert.«
Was das Image der Kibbuzim angeht: Ich glaube, es gibt immer noch Anhänger des rechten Ministerpräsidenten, das »Bibi-Team«, die »Netanyahu-Fanboys«, und vom rechten Kanal 14. Und es gibt Menschen, die einer Art Gehirnwäsche unterzogen wurden, so dass es schwer ist, ihre Ansichten zu ändern. Aber die Kibbuzim zeigten Mut und Stärke. Und so hoffe ich, dass es Menschen geben wird, die ihre Meinung über uns ändern und anfangen, die Kibbuzim mehr zu schätzen. Es gibt viele weitverbreitete Klischees über uns. Und wir könnten sicherlich auch mehr tun, um für die anderen zugänglicher zu sein.
Innerhalb der Gruppe der Evakuierten gibt es Debatten darüber, was als Nächstes zu tun ist: zurückkehren oder bleiben, wohin sie geflohen sind. Der Journalist Anshel Pfeffer warnte kürzlich in Haaretz, dass die betroffenen Kibbuzim nicht eine weitere Gedenkstätte, ein zweites Yad Vashem werden sollten. Wie sehen Sie das?
Die Frage, ob man zurückkehren soll oder nicht, ist kompliziert. Es gibt Menschen, für die Kibbuzim nun Tod und Angst bedeuten – den Tod ihrer Angehörigen oder ihre eigene Nahtoderfahrung –, die mental einfach nicht mehr zurückkönnen. Viele Familien mit kleinen Kindern weigern sich, zurückzukehren, wenn es keine hundertprozentige Garantie für ihre Sicherheit gibt. Sie sagen, dass sie dort jahrzehntelang gelebt haben unter der Bedrohung durch Raketen und Terror. Aber sie haben dort weitergelebt, weil sie geglaubt haben, dass der Staat sie verteidigen kann. Er konnte es nicht.
Ich kann nicht für sie sprechen, bin mir aber sicher, dass einige Leute zurückgehen werden. Einige haben es bereits getan, vor allem die Älteren, die über 60jährigen, die viel durchgemacht und keine Angst haben, und auch die jüngeren Abenteurer in ihren Zwanzigern, die keine Kinder haben. Aber es gibt viele Menschen, für die es wahrscheinlich zu traumatisch ist, ob jung oder alt. Der Zweck der Kibbuzim im Süden und Norden war es immer, als Vorposten, als Sicherheitspuffer für die israelische Gesellschaft zu dienen. Das hat sich geändert.
Wo sehen Sie sich und Ihre Familie in der Zukunft?
Ich lebe gerne im Kibbuz. Ich denke, dass die Kibbuzim sich mehr modernisieren könnten, aber ich möchte nicht in einem privatisierten, kapitalistischen Kibbuz leben. Das ist kein Kibbuz mehr, es ist dann nur irgendein Dorf, irgendein Vorort. Und natürlich gibt es eine Menge Regeln. Man kann manchmal davon erschöpft sein. Ich gehe beispielsweise fast nie zu den Treffen. Aber hier ist fast jedes Mitglied in einem Gremium oder Team tätig. Früher war ich Redakteur der hauseigenen Kibbuzzeitschrift. Vor Januar 2023 hatten wir auch regelmäßige Wochenendjobs – alle vier Wochen musste man am Wochenende arbeiten. Ich habe vor allem in unserem Kindervergnügungspark Kiftzuba Tickets verkauft. Ich bin das erste männliche Mitglied des Gleichstellungsteams. Wir sind dafür verantwortlich, das Bewusstsein für die Gleichberechtigung der Geschlechter im Kibbuz zu schärfen und wurden professionell zu Fragen sexueller Belästigung geschult.
In Israel wird derzeit häufiger der Mangel an Frauen in Entscheidungspositionen problematisiert, es gibt Forderungen, dass sich daran etwas ändern müsse. Im Kriegs- und im Sicherheitskabinett ist keine einzige Frau vertreten. Wie schätzen Sie die Situation ein? Können die Kibbuzim eine Vorbildfunktion einnehmen?
Innerhalb der israelischen Gesellschaft gibt es viele Verbesserungen. In vielen leitenden Positionen sieht man sowohl Frauen als auch Mizrahim. Diese Stereotype treffen also nicht mehr zu. Aber ich denke, dass die Thematik im Kibbuz subtiler ist. Zum Beispiel der Wachdienst: Die Patrouillen sind nur für Männer vorgesehen. In unseren Kindergärten und Vorschulen arbeiten dagegen nur Frauen. Man sieht also immer noch viele klassische Geschlechterrollen – selbst in einer Gesellschaft wie unserer, die angeblich progressiv ist. Es ist ein langer Prozess. Es sind kleine Schritte, aber immerhin.
*
Jonathan Grossman ist Postdoktorand am Jacob Robinson Institute for the History of Individual and Collective Rights an der Hebräischen Universität Jerusalem und lehrt dort im Fachbereich Internationale Beziehungen. 2013 schloss er sich dem Kibbuz Tzuba an. Er lebt dort mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern.





 Im traurigen Hier und Jetzt
Im traurigen Hier und Jetzt